EZB-Stresstest 2026: Geopolitische Risiken im Fokus und eine neue Methodik
Beim ersten inversen Stresstest müssen Banken ein eigenes Extremszenario entwickeln.
Keyfacts:
- Der EZB-Stresstest 2026 ist anders als alle anderen zuvor: Er rückt erstmals geopolitische Risiken in den Mittelpunkt.
- Eine weitere Premiere: Banken müssen ein individuelles Extremszenario entwickeln – und selbst bewerten, wie sich geopolitische Schocks auf Kapital, Liquidität und Risikoexponierung auswirken.
- Die neue Methodik erfordert eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Szenario-Design, Governance-Strukturen und Datenprozessen – Banken sollten jetzt handeln.
Im kommenden Jahr steht den Banken im Euroraum turnusgemäß ein Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) bevor – doch dieser ist anders als alle vorherigen. Denn die Institute müssen methodisch neue Wege beschreiten. Erstmals fordert die EZB die von ihr beaufsichtigten Institute im Rahmen eines sogenannten inversen Stresstests („Reverse Stresstest“) auf, ein eigenes Szenario zu geopolitischen Risiken zu entwickeln.
Banken müssen also nicht, wie üblich, auf ein von der Aufsicht vorgegebenes Szenario reagieren, sondern sollen selbst ein passendes geopolitisches Szenario entwickeln – orientiert an der von der EZB vorgegebenen Minderung der Kapitalquote.
Ziel ist es, die eigene Verwundbarkeit gegenüber politischen Schocks zu erkennen – und zu analysieren, wie sich geopolitische Veränderungen auf Kapital, Liquidität und Geschäftsmodell auswirken.
Der Test ist Teil des zweijährlichen EZB-Stresstest-Zyklus, der zuletzt Klimarisiken (2022) und Cyberrisiken (2024) thematisierte. Für den Zeitraum 2025-2027 hat die EZB geopolitische Risiken ausdrücklich als aufsichtliche Priorität definiert – nicht zuletzt angesichts wachsender globaler Krisen.
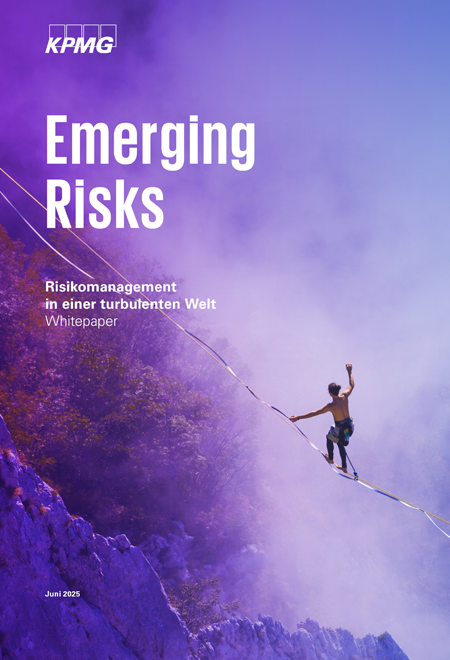
Emerging Risks
In einer zunehmend unsicheren Welt braucht Risikomanagement neue Werkzeuge, Denkweisen und Strukturen. Unsere Publikation zeigt, wie Organisationen sich aufstellen können.
Studie herunterladenEZB verschiebt den Fokus hin zu Selbstreflektion und Eigenverantwortung
Neu sind also dieses Mal gleich zwei Dinge: der thematische Fokus und die Methodik: Die Banken müssen selbst ein für ihr Geschäftsmodell relevantes Extremszenario entwickeln, das innerhalb von drei Jahren zu einer Reduktion der CET1-Quote um 300 Basispunkte führt.
Damit verschiebt sich der Fokus von der Analyse eines vorgegebenen Szenarios hin zur aktiven Selbstreflexion: Welche geopolitischen Risiken betreffen das eigene Institut besonders – und über welche Kanäle wirken sie sich wie aus?
Die Analyse soll finanzielle und nicht-finanzielle Effekte berücksichtigen und auf bestehende ICAAP- (Internal Capital Adequacy Assessment Process) und Stresstest-Rahmenwerke aufbauen. Die Ergebnisse fließen direkt in den jährlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) – in diesem Fall also für 2026 – ein.
Der EZB-Stresstest: Was zu Zeitplan und Anforderungen bis jetzt bekannt ist
Nach aktuellem Stand werden im November die teilnehmenden Banken benannt. Der Test startet voraussichtlich im Januar 2026, die Ergebnisse sind bis zum 16. März 2026 einzureichen. Die Auswertung erfolgt im zweiten Quartal – mit möglichem Nachbesserungsbedarf.
Quelle: KPMG 2025; Angaben basieren auf bisherigen Angaben der EZB und auf Erfahrungen aus vorherigen Stresstests.
Besonders fordern werden Banken die hohen Anforderungen an die Detailtiefe bei der Analyse der Risikotreiber und ihrer Auswirkungen: Neben den eigentlichen drei Stresstest-Templates sind vier weitere Fragebögen auszufüllen, in denen qualitative und quantitative Aspekte des entwickelten Szenarios zu beschreiben sind – bis hin zu Detailanalysen nach Regionen und den NACE-Sektoren der Europäischen Union (einer statistischen Systematik der Wirtschaftszweige).
Die Vorbereitung: Was Banken jetzt tun sollten
In den meisten Banken werden die dafür benötigten Daten nicht strukturiert vorliegen. Es empfiehlt sich daher, möglichst schnell Verantwortungen und Rollen zu definieren, sich intensiv mit der Methodik und den Anforderungen des inversen Stresstests zu beschäftigen und eine belastbare Dateninfrastruktur mit bereichsübergreifenden Abstimmungsprozessen zu etablieren:
- Governance
Ein effektives Governance-Modell ist die Grundlage für einen erfolgreichen Stresstestprozess. Wir empfehlen, frühzeitig eine verantwortliche Projektleitung zu benennen – idealerweise mit Erfahrung im aufsichtsrechtlichen Stresstesting und mit Kenntnissen der technischen Berichtsanforderungen.
kk
Die Rollen und Verantwortlichkeiten sollten klar über die relevanten Funktionen hinweg definiert werden: Risikomanagement, regulatorisches Meldewesen, Controlling beziehungsweise Finanzplanung (insbesondere im Hinblick auf die ICAAP-Perspektive), makroökonomische Analyse sowie die regulatorische Koordination. Zusätzlich sollte ein Zielbild dafür erarbeitet werden, wie geopolitische Risiken strukturell im ICAAP verankert werden können – auch über den Stresstest hinaus. - Methodik
Zunächst gilt es zu prüfen, ob im Institut bereits ein Rahmenwerk für inverse Stresstests vorhanden ist – und falls ja, wie es für geopolitische Risiken erweitert werden kann. Es empfiehlt sich, eine umfassende Liste potenzieller Risikotreiber und Übertragungskanäle zu erstellen, verbunden mit einer Einschätzung ihrer Wesentlichkeit im bestehenden ICAAP.
s
Qualitative Aspekte und mögliche Narrative für Szenarien sollten frühzeitig analysiert werden – inklusive Überlegungen zur Eintrittswahrscheinlichkeit und zur notwendigen Schärfe des Szenarios. Ziel ist es, ein realistisches, aber dennoch belastendes geopolitisches Schockszenario zu definieren, das sowohl quantitative als auch qualitative Dimensionen abdeckt. - Reporting
Nachdem die Datenanforderungen analysiert wurden, sollten alle Berichtsfelder systematisch auf mögliche Lücken überprüft werden. Für jede identifizierte Lücke ist zu entscheiden, ob sie durch bestehende Datenquellen geschlossen werden kann oder ob Übergangslösungen (als Workarounds) notwendig sind.
s
Insbesondere der qualitative Teil des EZB-Fragebogens kann – soweit möglich – bereits vorab vorbefüllt werden. Das erleichtert die spätere Konsistenzprüfung und spart wertvolle Zeit in der engen Umsetzungsphase Anfang 2026.
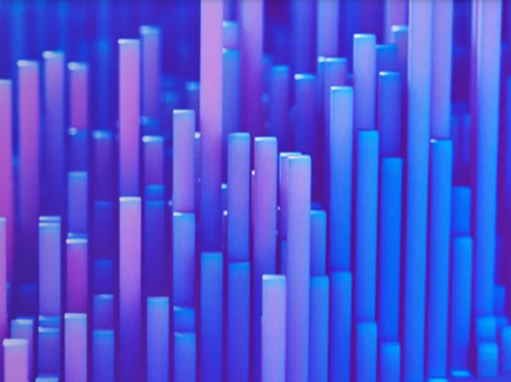
Stress Testing im Fokus – EBA und EZB setzen neue Maßstäbe
Was Kreditinstitute jetzt beachten müssen und wie sie sich strategisch auf die nächste Stresstest-Runde vorbereiten.
Jetzt informierenVom Pflichtprogramm zur Chance: Geopolitische Risiken im Risikomanagement verankern
Die Vorbereitungszeit ist knapp – zumal der „Reverse Stresstest“ ein Umdenken erfordert und sich die Erfahrungen aus früheren Tests nur bedingt übertragen lassen. Nicht mehr „Was passiert, wenn…?“ steht im Mittelpunkt, sondern „Was müsste passieren, damit…?“.
Hinzu kommt, dass die notwendigen Vorarbeiten für die Stresstests der EZB für Banken jedes Mal eine zusätzliche Belastung in den ohnehin hektischen Wochen des Jahresabschlusses darstellen. Doch gerade deshalb sollte der Stresstest 2026 nicht nur als regulatorische Pflicht verstanden werden.
Er bietet die Chance, geopolitische Risiken – wie Zölle oder die Entkopplung von Wirtschaftszonen – systematisch im Risikomanagement zu verankern und das eigene Institut strategisch resilienter aufzustellen.










