Digitale Ökosysteme als Quelle für Innovationen
In Netzwerken schlummert enorme kreative Kraft – es wird Zeit, sie zu wecken.
Disruptive Technologien und resultierende Transformationsprozesse stellen Entscheider vor immer komplexere Herausforderungen. Sie sollen agile Geschäftsmodelle und -abläufe entwerfen, Produktentwicklungsprozesse flexibel dem Bedarf anpassen und sich auf immer kürzere Lebenszyklen von Produkten (PLC) und Technologien (TLC) einstellen. Kurz: sich permanent neu erfinden, in schneller Abfolge.
Dieser Innovationsdruck überfordert schnell einzelne Unternehmen und Organisationen. Um nicht den Anschluss oder gar ihre Existenzgrundlage zu verlieren, brauchen sie Impulse von außen. Eine Lösung: Offene Innovation, durch produktiv genutzte digitale Ökosysteme auf Basis sozialer Netzwerke. Leider wird diese Chance von globalem Wissen zu profitieren, noch viel zu selten genutzt.
Bündnisse machen innovativer
Natürlich sind Unternehmen und Institutionen längst über Plattformen wie LinkedIn, Xing, Facebook oder auch Instagram mit Menschen in aller Welt weitverzweigt verbunden. Allerdings führen sie mit diesen oft nur eine Einbahnstraßen-Kommunikation. Zwar werden rege Informationen – sei es für Marketingzwecke oder zur Auftragsabwicklung – an Geschäftspartner und Kunden abgesetzt. Aber ein sich gegenseitig befruchtender Austausch über diese Kanäle hat Seltenheitswert. Das sollte sich ändern.
Generell ist der digitale Innovationsdruck bei den Unternehmen groß, um am Markt bestehen zu können. So verbünden sich zum Beispiel einige stationäre US-Handelsketten mit Microsoft, um mit neuen Einkaufs- und Bezahlkonzepten gegen den übermächtigen Online-Marktplatz Amazon ins Feld zu ziehen. Und auch in anderen Bereichen setzen digitale Technologien neue Maßstäbe. So will die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam bis zur Fußball-EM 2020 das innovativste Stadion des Kontinents werden – Technologien wie Augmented- und Virtual-Reality, Digital-Payment und neue Formen der Interaktion sind dafür unverzichtbar. Beide Projekte stehen auch für den zunehmenden Druck, gemeinsam mit Partnern Innovationen hervorzubringen. Dafür setzen sie neben Kollaborationen mit ausgewählten Alliierten stark auf die kreative Masse digitaler Ökosysteme – denn den so generierten Ideenpool würden sie im Alleingang nie füllen können.
Ideen mit „Innovation Challenges“ generieren
Wenn Unternehmen das Wissen eines Ökosystems anzapfen wollen, benötigen sie zunächst eine digitale Anlaufstelle, über welche sich die Mitglieder der verschiedenen Netzwerke austauschen können. Das kann beispielsweise eine Open-Innovation-Plattform sein. Ausgehend vom zentralen Ziel des Vorhabens sind geeignete Menschen für den kreativen Input zu finden. Neben internen Beteiligten kommen dafür Geschäftspartnerinnen und -partner, Start-ups, Bildungseinrichtungen, staatliche Stellen, Kundinnen und Kunden, ja sogar Wettbewerber infrage.
Im nächsten Schritt wird die Masse an Kontakten strukturiert gemanagt. Dies geschieht über zeitlich limitierte „Innovation Challenges“, in denen man mit anderen Kreativen sowie neuen Denkansätzen und -Methoden einzelne Themenblöcke bearbeitet. Diese werden aus der Hauptherausforderung der Fragestellung zugeschnitten. Mit jedem dieser Themenblöcke beschäftigt sich eine heterogene Gruppe und generiert dazu Ideen. Ist die „Innovation Challenge“ abgeschlossen, werden Ergebnisse nach zuvor definierten Kriterien bewertet und idealerweise bis zum Ende umgesetzt.
Ein großer Vorteil eines solchen digitalen Ökosystems ist: Bei Bedarf kann es jede Interessensgruppe um eigene Kontakte in den sozialen Netzwerken erweitern. Und diese Kontakte erweitern es wiederum. So entsteht ein kaskadierendes System mit einer nahezu beliebig großen Anzahl von Mitwirkenden. Das ist sinnvoll, weil es auch die Masse macht. Sie ist laut „Harvard Business Review“ einer der vier elementaren Erfolgsfaktoren für die Gewinnung von Ideen aus Ökosystemen. Die anderen sind eine hohe Frequenz von „Innovation Challenges“, ein vielfältiges Feedback zu den Vorschlägen sowie heterogen zusammengestellte Gruppen.
Orchestrieren, kollaborieren und profitieren
Die Technologie für netzwerkbasierte Wissenskollaborationen ist vorhanden. Erforderliche Strukturen für „Innovation Challenges“ können Organisationen im Alleingang einführen oder auch Netzwerkeffekte gemeinsam mit einem Partner erzielen. Auf Dauer sollten die innovativen Prozesse in digitalen Ökosystemen nach einer Einschwingphase selbstständig laufen und von den jeweiligen Unternehmen selbst orchestriert werden. Somit entsteht ein aktives Ökosystem, das sich gegenseitig inhaltlich befeuert.
Der dreifache Lohn der Mühe: Erstens liefern „Innovation Challenges“ Ideen, die sonst nicht entstanden wären. Zweitens fördern sie durch die Beteiligung der eigenen Mitarbeiter die interne Innovationskultur. Und drittens, haben sie einen großen Marketingeffekt. Wer darauf verzichtet, wird Herausforderungen früher oder später nicht mehr bewältigen können und vom Markt verschwinden.
Eine gemeinsame Sprache für digitale Ökosysteme
Die Kommunikation in digitalen Ökosystemen setzt ein gemeinsames Verständnis der Ziele, Abläufe und auch Begrifflichkeiten unter allen Beteiligten voraus. Definieren die Interessengruppen diese ungewollt unterschiedlich, dann kann es zu schwerwiegenden Missverständnissen kommen, welche Projekte erschweren oder sogar scheitern lassen. Deswegen wurde der neue ISO-Standard 56002 entwickelt. Er fördert den Aufbau strukturierter Innovation-Management-Systeme in Organisationen und macht sie steuer-, mess- und vergleichbar.
Disruptive Technologien sind für Unternehmen Chance und Herausforderung zugleich. Für Entscheider ist die aktive Auseinandersetzung mit ihnen unumgänglich, denn die Entwicklung des eigenen Unternehmens ist untrennbar damit verbunden – egal in welcher Branche man heute tätig ist. Ein Grund düster in die Zukunft zu blicken besteht dabei nicht, denn die sich bietenden Chancen sind überwältigend, gerade auch wenn man mögliche Kooperationen in Betracht zieht. Und wirtschaftlich durchaus lukrativ.
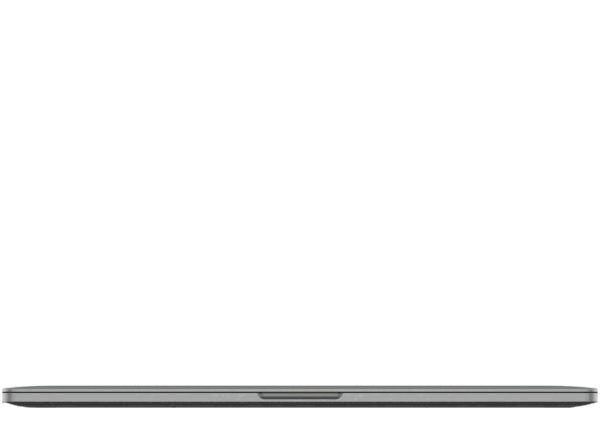
Digitale Reifegradanalyse
Wie digital ist Ihre Organisation?
Nutzen Sie unsere Business Analytics und ermitteln Sie Ihren digitalen Reifegrad anhand eines ganzheitlichen Dimensionenmodells.
Jetzt Bewertung starten







