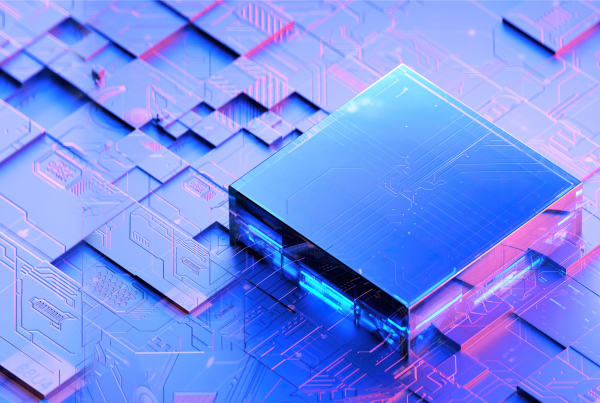AFC-Compliance modernisieren: So finden Banken den richtigen Provider
Transaktionsmonitoring: Klare Auswahlprozesse senken Kosten und stärken Compliance
Keyfacts:
- Die Kosten für die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti-Financial-Crime-Compliance, AFC) steigen insbesondere durch hohe Personalaufwendungen.
- Technologische Investition ist der wesentliche Treiber für Automatisierung und Effizienz.
- Am Beispiel des Transaktionsmonitorings zeigt sich, wie Banken systematisch den passenden Provider finden.
Seit Jahren sehen sich Finanzinstitute mit wachsenden regulatorischen Anforderungen konfrontiert, wie jüngst mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung samt der geplanten Regulatory Technical Standards (RTS) und Implementing Technical Standards (IST). Die Antwort darauf war bislang häufig: mehr Personal, mehr Ressourcen, mehr manuelle Kontrolle. Doch dieser Ansatz stößt zunehmend an seine Grenzen – finanziell wie operativ. Laut aktuellen Erhebungen berichten 98 Prozent der Finanzinstitute in der EMEA-Region von gestiegenen Kosten für die Anti-Financial-Crime-Compliance (AFC-Compliance) – ein Großteil davon verursacht durch höhere Personalkosten.
Um diese Kosten langfristig zu senken und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, setzen immer mehr Institute auf gezielte Technologieinvestitionen. Richtig eingesetzt wird Technologie so zum zentralen Hebel, um die wachsende Belastung im Compliance-Bereich nachhaltig zu reduzieren.
Diese Erkenntnis ist inzwischen auch auf Entscheiderebene angekommen. Laut dem aktuellen KPMG Global Chief Ethics and Compliance Officer Survey erwarteten über 70 Prozent der befragten Chief Compliance Officers (CCO) im vergangenen Jahr steigende Budgets für Compliance-Technologie – 56 Prozent rechneten mit einem Anstieg von fünf bis zehn Prozent. Die Bereitschaft, in moderne Systeme zu investieren, ist damit klar erkennbar.
Doch technologische Lösungen entfalten ihren Nutzen nur, wenn sie passgenau ausgewählt werden – insbesondere im Kontext bestehender IT-Strukturen. Genau dafür braucht es einen strukturierten, methodisch fundierten Selektionsprozess.
Wie dieser Auswahlprozess in der Praxis funktioniert, zeigt sich am Beispiel des Transaktionsmonitorings – einem besonders sensiblen und regulatorisch relevanten Anwendungsfall.

Studie: Compliance weiterdenken – Insights für moderne Governance-Strukturen
Was Unternehmen branchenübergreifend tun, um ihre Compliance-Funktion wirksamer und effizienter aufzustellen.
Jetzt Studie herunterladen-
1. Ist-Analyse
Systematisch werden bestehende technische, organisatorische und prozessuale Maßnahmen zur Überwachung von Transaktionen erfasst – etwa durch Interviews, Dokumentenanalysen und Architektur-Reviews. Anschließend erfolgt ein Abgleich mit den regulatorischen Anforderungen (insbesondere BaFin AuA BT) sowie mit etablierten Better Practices.
Vorteil: Eine frühe Analyse schafft Transparenz über bestehende Schwachstellen und Abhängigkeiten. Gleichzeitig lassen sich Funktionalitäten mit geringem Nutzen im Zielsystem vermeiden.
-
2. Zieldefinition und Scoping
Festlegung der strategischen Zielsetzung des Projekts, etwa die Einführung einer gruppenweiten Lösung mit verbesserter Alert-Qualität und effizientem Case Management. Darauf aufbauend wird der organisatorische und technische Projektumfang definiert – also welche Organisationseinheiten, Gesellschaften und parallel laufende Projekte einbezogen werden.
Vorteil: Ein klarer Fokus verringert den Aufwand und reduziert die notwendigen Abstimmungen – sowohl im Projektverlauf als auch in der anschließenden Implementierung.
-
3. Definition der Anforderungen
In strukturierten Workshops und Interviews mit relevanten Organisationseinheiten werden funktionale Anforderungen – etwa regel- und modellbasierte Erkennung, Schwellenwertkalibrierung, Case Management – sowie nicht-funktionale Aspekte wie Performance und Auditierbarkeit gesammelt. Ergänzend fließen weitere Anforderungen bzw. Kriterien ein, beispielsweise die Integration in bestehende Infrastrukturen. Alle Ergebnisse werden anschließend in einer Bewertungsmatrix zusammengeführt.
Vorteil: Klar definierte Anforderungen schaffen Vergleichbarkeit zwischen potenziellen Lösungen und beugen späteren Nachverhandlungen vor.
-
4. Longlist
Auf Basis von Expertenwissen, Online-Recherche und Empfehlungen werden potenzielle Anbieter identifiziert. Eine erste Prüfung erfolgt anhand von Mindest- bzw. K.-o.-Kriterien – etwa Cloud-Fähigkeit oder Unterstützung des Vier-Augen-Prinzips und revisionssicherer Dokumentation. Diese Kriterien bilden eine Teilmenge der Bewertungsmatrix und dienen dazu, ungeeignete Anbieter bereits in einer frühen Phase auszusieben. Das Ergebnis ist eine Longlist relevanter Kandidaten für die nächste Auswahlphase.
Vorteil: Durch den frühzeitigen Ausschluss unpassender Anbieter lassen sich unnötige Evaluierungsschleifen vermeiden.
-
5. Shortlist
Auf Basis der definierten Anforderungen wird ein strukturiertes Ausschreibungsverfahren vorbereitet. Die Unterlagen – inklusive Anforderungskatalog und Kontextinformationen – gehen an die Anbieter der Longlist. Nach Klärung offener Fragen werden die Angebote bewertet, sodass eine Shortlist relevanter Anbieter entsteht.
Vorteil: Eine transparente Entscheidungsgrundlage erleichtert die Abstimmung mit Management, Compliance, IT und Revision.
-
6. Proof of Concept (PoC)
Im nächsten Schritt werden konkrete Anwendungsfälle und funktionale Anforderungen ausgewählt, die von den Anbietern demonstriert werden. In Proof-of-Concept-Sitzungen wird mit synthetischen oder anonymisierten Transaktionsdaten geprüft, wie gut sich die Lösungen umsetzen lassen. Bewertet werden dabei die Erkennungsqualität, die Benutzerfreundlichkeit, die Transparenz sowie Kosten.
Vorteil: So entsteht eine fundierte Einschätzung – insbesondere in Bezug auf spezifische Anforderungen sowie auf initiale und laufende Kosten.
-
7. Finale Bewertung
Die Bewertungsmatrix wird mit den Ergebnissen aus Proof of Concept und Angebotsphase aktualisiert. Offene Punkte zu Preis, Lizenzmodell, Integration oder Customizing werden final geklärt. Auf dieser Basis entsteht eine Entscheidungsunterlage, die Kosten, Nutzen, Risiko und Umsetzbarkeit umfassend bewertet.
Vorteil: Das Ergebnis ist eine dokumentierte und belastbare Entscheidung, die gegenüber Revision und Management transparent nachvollzogen werden kann.
-
8. Contracting
Mit dem ausgewählten Anbieter werden die Verträge verhandelt und abgeschlossen. Dabei spielen Service Level Agreements, Exit-Strategien (z. B. Datenmigration bei Anbieterwechsel) und Regelungen zum Customizing und Release-Management eine zentrale Rolle.
Vorteil: Klare Regelungen schaffen Verbindlichkeit und minimieren potenzielle Reibungspunkte im weiteren Verlauf.
-
9. Projektplanung
Nach Vertragsabschluss wird gemeinsam mit dem Anbieter ein Projektplan erstellt. Darin werden Rollen, Verantwortlichkeiten, Meilensteine und Kommunikationsstrukturen festgelegt. Ergänzend erfolgt der Aufbau einer Projektgovernance mit Lenkungskreis sowie Change- und Risikomanagement.
Vorteil: Klare Strukturen steigern die Qualität und senken das Risiko in der Umsetzung.
Trotz der Standardisierung bleibt der Ansatz flexibel und kann präzise an die individuellen Anforderungen und Prioritäten des Finanzinstituts angepasst werden. Dazu gehört unter anderem die Definition und Gewichtung der Kriterien, anhand derer potenzielle Anbieter bewertet werden, um den Auswahlprozess optimal an die jeweiligen Zielsetzungen anzupassen. So entsteht eine belastbare Entscheidungsgrundlage, die langfristig zu einer effektiven und maßgeschneiderten Umsetzung beiträgt.

Geldwäscheprävention wird datengetrieben
Wie sich die Erwartungen der Aufsicht verändern – und was Institute jetzt leisten müssen.
Beitrag lesenTypische Herausforderungen und Lösungsansätze aus der Marktpraxis
Entscheidend ist, wie in den einzelnen Phasen mit typischen Reibungspunkten umgegangen wird. Machen wir es konkret:
Welche potenziellen Herausforderungen entstehen in den einzelnen Phasen im Kontext des Transaktionsmonitorings – und wie kann ihnen begegnet werden?
- Ist-Analyse: Häufig zeigt sich, dass Transaktionsflüsse und beteiligte Systeme dezentral dokumentiert oder nur unvollständig in den Überwachungsprozess eingebunden sind. Um dies zu adressieren, empfiehlt sich eine abteilungsübergreifende Analyse aller relevanten Transaktionen, Systeme und Prozesse – inklusive Kernbank- und Schnittstellensystemen. Ziel ist es, Transparenz über Datenflüsse zu schaffen und mögliche Schattenprozesse zu identifizieren.
dabc - Zieldefinition und Scoping: Oft bestehen Unsicherheiten, welche Transaktionstypen, Geschäftsbereiche oder Gesellschaften in den Überwachungsumfang aufgenommen werden sollen. Hier hilft es, gemeinsam mit allen Stakeholdern den Projektfokus klar zu definieren – etwa welche Transaktionen überwacht werden müssen, welche Reporting-Pfade gelten und wie der Automatisierungsgrad ausgestaltet sein soll. Ein eindeutig abgesteckter Umfang erleichtert die Planung, reduziert Abstimmungsbedarf und verhindert spätere Erweiterungen ohne Anpassung von Ressourcen oder Zeitplan.
dabc - Definition der Anforderungen: Häufig zeigt sich ein unzureichend abgestimmtes Bild zwischen fachlichen, technischen und regulatorischen Perspektiven. Hier hilft ein strukturiertes Vorgehen mit klarer Priorisierung – etwa durch die Einteilung in Muss-, Soll- und Kann-Anforderungen –, ergänzt durch abgestimmte Dokumentationen und iterative Abstimmungsschleifen.
dabc - Longlist: Diese Phase wird durch eine oft unübersichtliche Anbieterlandschaft mit vielen Nischenlösungen und geringer Markttransparenz erschwert. Ein systematisches, herstellerunabhängiges Vorgehen mit nachvollziehbarer Bewertungslogik schafft hier die Grundlage für fundierte und objektive Entscheidungen bei der Anbietervorauswahl.
dabc - Shortlist: Es zeigt sich, dass Anbieter Anforderungen unterschiedlich interpretieren und in variierender Detailtiefe beantworten. Das erschwert die Vergleichbarkeit und kann zu Fehleinschätzungen bei Kosten und Aufwand führen. Detaillierte Anforderungskataloge, standardisierte Rückmeldeformate und proaktive Kommunikation mit allen Kandidaten erhöhen die Vergleichbarkeit und reduzieren Fehleinschätzungen von Aufwand und Kosten.
dabc - Proof of Concept (PoC): Anbieter präsentieren generische oder zu technisch orientierte Demos, die kaum Rückschlüsse auf den tatsächlichen Praxiseinsatz zulassen. Aussagekräftige Ergebnisse entstehen nur, wenn realitätsnahe Anwendungsfälle und Testdaten frühzeitig definiert und mit den Anbietern abgestimmt werden – einschließlich klarer Erwartungen an Transparenz und Funktionstiefe.
dabc - Finale Bewertung: Diese Phase wird in vielen Projekten durch Unsicherheiten oder interne politische Einflussnahmen verzögert. Strukturierte Bewertungsverfahren mit nachvollziehbarer Gewichtung und faktenbasierter Argumentation schaffen hier die notwendige Entscheidungsreife – insbesondere dann, wenn alle relevanten Entscheidungsträger eng eingebunden sind.
dabc - Contracting: Verzögerungen und Missverständnisse entstehen häufig, wenn die vertragliche Ausgestaltung von Transaktionsmonitoring-Lösungen zu spät oder nur unvollständig adressiert wird. Besonders wichtig sind klare Regelungen zu Implementierungs- und Releasezyklen, Test- und Abnahmeumgebungen sowie zum vereinbarten Funktionsumfang.
dabc - Projektplanung: Unklare Rollenverteilungen, fehlende Ressourcen oder unzureichende Governance-Strukturen können direkt zum Projektstart zu Reibungsverlusten führen. Entscheidend ist, Schlüsselrollen frühzeitig zu besetzen, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und ein belastbares Steuerungsmodell inklusive Eskalationspfaden und Kommunikationswegen zu etablieren.
dabc
Zukunftssichere Entscheidungen in einem komplexen Regulierungsumfeld
Angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen und steigender Belastungen für Compliance-Funktionen gewinnen strukturierte Entscheidungsprozesse strategisch an Bedeutung. Der vorgestellte Selektionsansatz bietet eine fundierte Grundlage, um technologische Lösungen zielgerichtet und nachvollziehbar auszuwählen – insbesondere in sensiblen Anwendungsfeldern wie der Überwachung von Kommunikationskanälen im Kontext potenziell strafbarer Handlungen.
Darüber hinaus ist der Ansatz auf weitere regulatorisch getriebene Technologieprojekte übertragbar, die im Zusammenhang mit neuen Vorgaben aus dem EU-AML-Paket (zum Beispiel KYC) oder der Instant-Payment-Verordnung wie der Echtzeit-Verifizierung von Zahlungsempfängern stehen.
In all diesen Fällen entstehen komplexe Anforderungen an Prozesse, Systeme und Datenflüsse. Deren Erfüllung macht eine strukturierte Auswahl geeigneter Lösungen besonders wichtig. Je größer und komplexer der Anwendungsfall und die zugrundeliegende IT-Architektur sind, desto entscheidender wird ein klar definierter, transparenter Auswahlprozess. Klare Phasen, transparente Bewertungskriterien und die frühzeitige Einbindung relevanter Stakeholder schaffen die Basis für tragfähige, regulatorisch belastbare und zukunftssichere Entscheidungen.
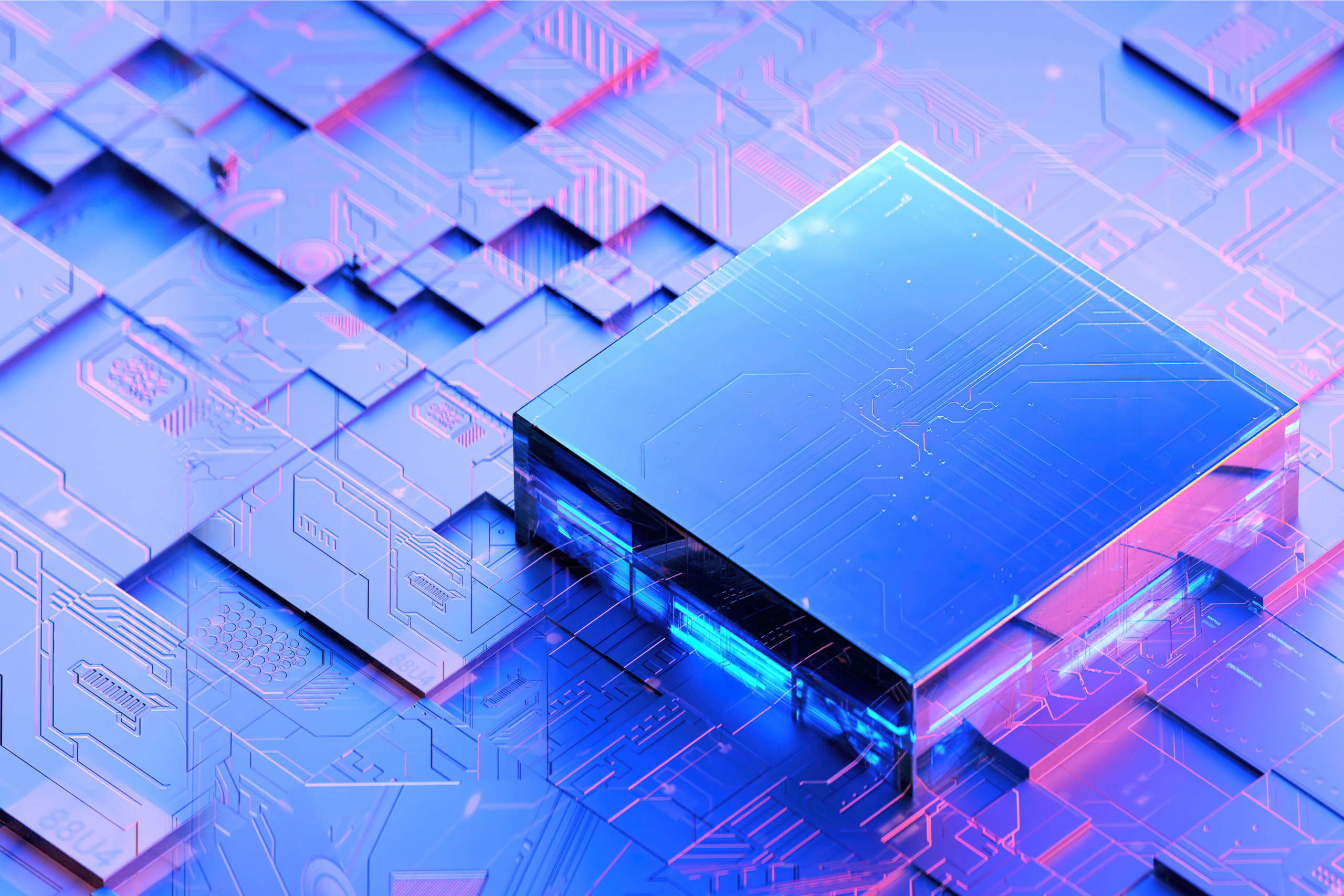
Das war die RegTech-Konferenz 2025
Alle Speaker:innen, Aussteller und die gesamte Agenda im Überblick.
Jetzt ansehen