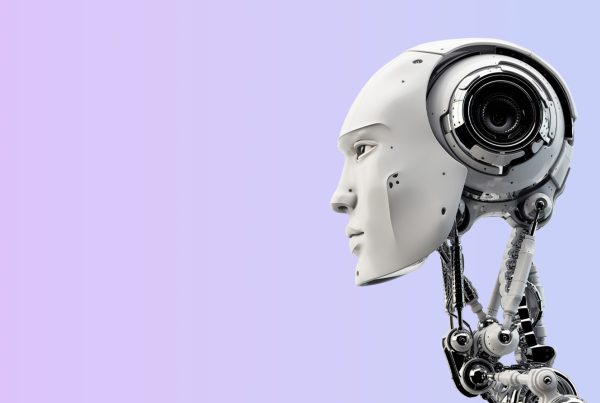Frage: Welche Quick Wins kannst du Unternehmen empfehlen, die gerade erst mit der KI-Umsetzung in ihren Abläufen starten?
Markus Hupfauer: Gerade in der Anfangsphase kommt es darauf an, pragmatisch zu starten – aber mit dem richtigen strategischen Unterbau. Drei Schritte liefern schnell echten Mehrwert und lassen sich mit überschaubarem Aufwand umsetzen.
Erstens: Automatisieren Sie Ihr KI-Inventar. Viele Unternehmen beginnen mit statischen Use-Case-Listen – aber das funktioniert bei KI nicht. Warum? Weil sich KI-Systeme in einem Tempo entwickeln, das klassische IT-Prozesse weit hinter sich lässt. Was heute noch eine Machbarkeitsstudie (Proof of Concept) ist, kann morgen produktiv genutzt werden – oft ohne formale Freigabe. Eine statische Tabelle ist da von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Was stattdessen hilft: ein automatisiertes Inventar, das KI-Komponenten in Systemen erkennt und klassifiziert, zum Beispiel durch technische Scans, Analysen der Schnittstellen (APIs) oder die Integration in das Change-Management. Hier setzen wir mit leichtgewichtigen Templates und Konnektoren an, die sich in bestehende IT-Service-Management-Tools wie ServiceNow, Jira oder Archer integrieren lassen.
Zweitens: Nutzen Sie Prompt Injection Testing und Firewalls. Die meisten Angriffe auf KI-Systeme sind heute keine Magie, sondern erschreckend simpel. Mit einer manipulierten Eingabe lassen sich viele Sprachmodelle dazu bringen, Geschäftsregeln zu unterlaufen oder ungewollte Inhalte auszugeben. Wir empfehlen schon in frühen Phasen gezielte Tests gegen die Eingabekanäle Ihrer KI. Die Resultate öffnen vielen die Augen.
Bündeln sie diese Erkenntnisse mit sogenannten Prompt Injection Firewalls oder Guardrails, um gezielt die Schwächen der KI-Modelle zu adressieren und einen sicheren und vertrauenswürdigen Betrieb der KI-Systeme sicherzustellen.
Drittens: Etablieren Sie ein Output Monitoring. Auch ohne vollständige Kontrolle über die Black Box KI kann man sehr wohl messen, was ein System liefert. Ein einfaches Monitoring auf Output-Stabilität – zum Beispiel anhand von Regeltreue, Antwortverhalten über Zeit oder Fehlerraten – schafft eine neue Ebene der Transparenz. Gerade wenn die KI Entscheidungen vorbereitet oder trifft, ist diese Transparenz elementar und letztlich betriebswirtschaftlich zwingend.
Diese drei Schritte lassen sich oft innerhalb weniger Monate implementieren und bilden die Grundlage für eine sichere Skalierung. Unsere Erfahrung aus KI-Transformationsprojekten in der Finanzindustrie zeigt: Wer früh strukturiert beginnt, spart später massiv Aufwand in der Kontrolle.