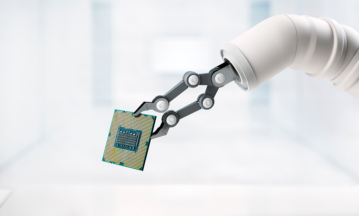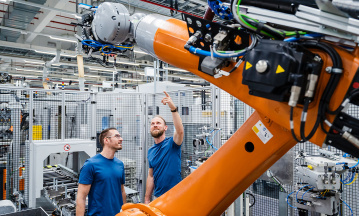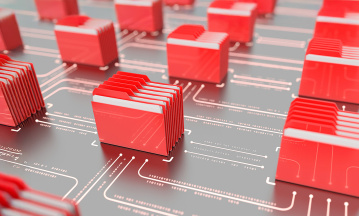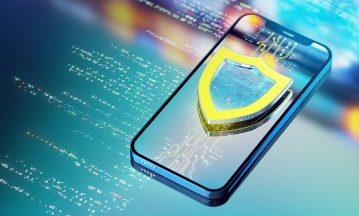Keyfacts:
- Der Digitale Produktpass (DPP) wird zur Pflicht – zuerst für die Textilbranche ab 2027.
- Unternehmen sollten Datenmanagement, Transparenz und Lieferketten neu denken.
- Frühzeitige Vorbereitung kann Compliance, Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile sichern.
Der Digitale Produktpass (DPP) kommt – und mit ihm neue Anforderungen an Transparenz, Datenmanagement und Compliance. Was bedeutet das konkret für Unternehmen? Die KPMG-Experten für Wertschöpfungsketten Dr. Kai Henke und Constantin Westkott geben Antworten.
Warum ist der Digitale Produktpass gerade jetzt ein so wichtiges Thema?
Kai Henke: Ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem Bereich nicht über-, sondern unterreguliert sind, denn Standards sind die DNA des Deutschen Mittelstandes. Ein Beispiel: Unternehmen A stellt Schrauben her und Unternehmen B stellt Muttern her. Beide Unternehmen halten sich an die DIN-Standards und die Produkte passen zusammen. Das, was wir in der analogen Welt gemacht haben, muss jetzt auch in der digitalen Welt gemacht werden und dafür brauchen wir den Digitalen Produktpass.
Regulatorisch gesehen ist der Digitale Produktpass Teil der Eco-design for Sustainable Products Regulation (ESPR), die bereits 2024 verabschiedet wurde. Das ursprüngliche Ziel des ESPR ist es, die ökologische Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit von Produkten zu verbessern. Ich erhoffe mir von dem DPP allerdings auch einen Effizienzgewinn: Weniger Excel und PDF und mehr Standards.
Die erste große Herausforderung wird der DPP für die Textil-Branche, die voraussichtlich ab 2027 zum DPP verpflichtet sein wird. Viele Details, wie die Definition der geforderten Datenpunkte werden erst sukzessive durch sogenannten „Delegierte Rechtsakte“ der EU konkretisiert. Wir erwarten den Delegierten Rechtsakt für Textil Anfang des Jahres. Nach deren Veröffentlichung bleiben den betroffenen Unternehmen nur 18 Monate zur Umsetzung. Das ist wenig Zeit, wenn man die Komplexität sowie die Breite der betroffenen Produktportfolio betrachtet. Wer jetzt nicht startet, riskiert operative Probleme, Bußgelder, Reputationsschäden und sogar ein Vertriebsverbot in der EU.
Was sind die größten Herausforderungen aus Sicht der Produktion?
Constantin Westkott: Die Anforderungen betreffen die gesamte Lieferkette. Wir sehen hier einen Wechsel von einer eindimensionalen zu einer ganzheitlichen Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette. Viele Unternehmen sind technisch und organisatorisch überhaupt nicht auf eine solche Transparenzpflicht vorbereitet. Es fehlen oft die organisatorischen und systemischen Grundlagen, um die nötigen Datenpunkte zu erheben, zu verarbeiten und in der Wertschöpfungskette weiterzureichen. Die Umsetzung ist nicht kurzfristig möglich, weil Transparenz bis in tiefe Lieferketten und die Einbindung vieler Akteure nötig ist. Das betrifft unter anderem Einkauf, Produktion, Vertrieb, IT und Compliance.
Wo liegen die größten Unsicherheiten bei der Umsetzung?
Kai Henke: Viele Details sind noch offen. Etwa welche Datenpunkte genau erfasst werden müssen oder beispielsweise welche Anforderungen an Datenaustausch, eindeutige Kennungen, Datenträger, Datenspeicherung gelten. Zudem können sich die Anforderungen durchaus nachträglich ändern, weil der Regulator mit dem Markt lernt, ähnlich wie bei anderen ESG-Regulatoriken. Unternehmen sollten also flexibel bleiben und sollten ihre Strukturen so aufbauen, dass sie auf Änderungen reagieren können.
Gibt es neben der Pflicht zur Umsetzung auch einen Mehrwert für Unternehmen?
Constantin Westkott: Definitiv. Ich sehe zwei Mehrwerte: Aktuell werden unzählige Dokumente in der Lieferkette von einer Stufe an die nächste Stufe übergeben. Das Problem dabei ist, dass jeder Abnehmer seine eigenen Anforderungen an die Datenpunkte, Datenformate und Kommunikationskanäle definiert. Es wäre ein deutlicher Mehrwert für alle Parteien in der Lieferkette, wenn diese Datenpunkte, -formate und Kommunikationskanäle standardisiert werden. Das gilt im Übrigen auch für den Austausch mit Behörden. Zweitens können Unternehmen die gewonnene Transparenz nutzen, um ihre Lieferketten zu optimieren, Risiken zu minimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln – etwa im Bereich der Kreislaufwirtschaft in Zeiten gestörter Handelsrouten und dem Recycling. Außerdem ergeben sich neue Marketing- und Customer-Service-Möglichkeiten, zum Beispiel durch QR-Codes, die Zusatzinformationen oder Rückabwicklungen bieten.
Was empfiehlt ihr Unternehmen jetzt zu tun?
Constantin Westkott: Unternehmen sollten sofort mit der Analyse ihrer Datenlage beginnen und die nötigen Strukturen aufbauen. Es ist wichtig, interdisziplinäre Teams zu bilden, die das Thema ganzheitlich angehen. Wer frühzeitig handelt, kann die Komplexität bewältigen und ist für regulatorische Änderungen besser gewappnet.
Kai Henke: Absolut, warten ist keine Option. Die Zeit bis zur finalen Regulierung sollte genutzt werden, um sich vorzubereiten. Neben der Initiierung eines interdisziplinären Teams, bestehend aus Einkauf, Produktion, Vertrieb, Compliance, Reporting, Datenmanagement und Nachhaltigkeit zur internen Vorbereitung und Aufwandsbudgetierung empfehle ich zwei weitere Maßnahmen: Erstens müssen die Lieferketten informiert werden, was zukünftig erwartet wird. Insbesondere Lieferanten mit Sitz außerhalb der EU sollten frühzeitig eingebunden werden, da ohne deren Zuarbeit kein DPP erstellt werden kann. Zweitens empfehle ich eine Bestandsaufnahme des bestehenden Datenmanagements. Diese Bestandsaufnahmen beinhaltet Analysen zur Datenverfügbarkeit und -vollständigkeit, genutzte Datenkanäle, Datenqualität und der Governance, wie mit Produktdaten intern gearbeitet wird. Denn eines ist klar: Wer jetzt startet, kann nicht nur Strafen und Vertriebsverbote vermeiden, sondern auch echten Mehrwert aus den neuen Anforderungen ziehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Webcast am 5. März 2026, 10:00–11:30 Uhr
Am 5. März zeigen wir Ihnen in unserem kompakten Webcast, wie Sie die neuen Anforderungen der Ökodesignverordnung (ESPR) nicht nur erfüllen, sondern strategisch für Ihr Unternehmen nutzen können. Jetzt noch anmelden: Digitaler Produktpass: Bürkratie oder brauchbar?