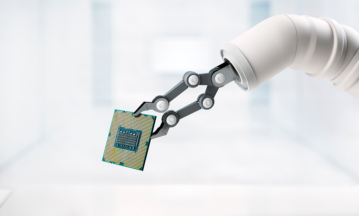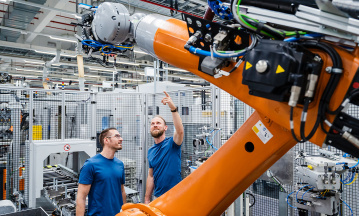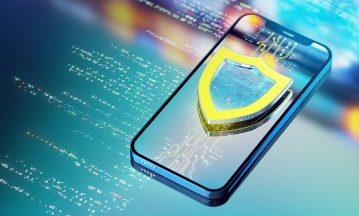Keyfacts:
- Die Buhlmann-Group schloss die Due Diligence für 17 Standorte in nur sechs Wochen ab.
- Pensionsgutachten, Forderungsstruktur und Anzahlungen hatten Einfluss auf den Kaufpreis.
- KPMG und die Buhlmann-Group arbeiteten in kurzen Abstimmungsschleifen mit klarer Priorisierung – ein Modell für künftige Transaktionen.
Enge Zeitpläne und viel Verhandlungsspielraum: Internationale Transaktionen verlangen hohe Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen.
Im Interview geben Philipp Tengel, CFO der Buhlmann-Group, einem internationalen Spezialisten für Rohrleitungs- und Anlagenbau, und Nelson Donovan, Director, Deal Advisory, KPMG, Einblicke in die besondere Dynamik einer internationalen Due Diligence: Die Buhlmann-Group hat im Jahr 2023 die LISEGA-Gruppe, einen internationalen Hersteller für Rohrhalterungen, gekauft.
Wie kam die Zusammenarbeit zustande und was war die Ausgangssituation?
Philipp Tengel: Den ersten Kontakt mit dem Target, der LISEGA-Gruppe, hatten wir im Sommer 2023. Für uns war sofort klar: strategisch ein sehr interessantes Unternehmen, weil es uns sowohl geografisch als auch inhaltlich neue Möglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig hatte der Deal mit rund 170-180 Millionen Euro Umsatz und 17 Standorten, davon 12 Produktionsstandorte in mehreren Ländern eine Dimension, die wir so bisher nicht kannten.
Wir sind erfahren in M&A, aber wir wussten auch: Diese Transaktion stemmen wir nicht allein. Entsprechend haben wir uns umgesehen, wer uns begleiten kann. Ich kenne KPMG seit Jahren aus Projekten, bei denen es auf Verlässlichkeit und Qualität ankommt.
Welche Ziele standen bei der Due Diligence im Vordergrund?
Philipp Tengel: Die zentrale Aufgabe war die Risikoabsicherung. Bei einem internationalen Unternehmen dieser Größe geht es darum, Risiken frühzeitig zu erkennen: Sind die Zahlen belastbar, gibt es Altlasten, wie sind die finanziellen Strukturen in den einzelnen Ländern?
Gleichzeitig wollten wir nicht nur Risiken aufzeigen, sondern auch Chancen identifizieren – also Werthebel, die in die Kaufpreisverhandlung einfließen können. Am Ende zählt das Gesamtbild: Risiken abfedern und zugleich Argumente für eine Preisgestaltung finden.
Wie sah die Zusammenarbeit operativ aus?
Nelson Donovan: Wir beginnen jede Due Diligence mit einem Kick-off: Wer macht was, wie sehen die Erwartungen aus, was ist der zeitliche Rahmen, was ist die Basis für die Bewertung? Danach arbeiten wir in kurzen, engen Abstimmungsschleifen. Mit Philipp konnten wir vieles sofort bilateral klären. Gleichzeitig gab es wöchentliche Updates, sodass alle immer auf demselben Stand waren.
Wichtig ist, Geschwindigkeit und Gründlichkeit zu verbinden. Der Zeitplan ist bei Due-Diligence-Prozessen immer eng, oberflächliche Arbeit aber keine Option. Deshalb fragen wir gezielt nach und bleiben so lange dran, bis die relevanten Antworten vorliegen. So werden die kritischen Punkte früh sichtbar.
Philipp Tengel: Man muss den Spagat schaffen: Der Verkäufer drückt meist aufs Tempo, aber als Käufer braucht man genug Tiefe, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Da hat das Team von KPMG uns geholfen, den Überblick zu behalten, Prioritäten richtig zu setzen und bei Datenlücken nicht lockerzulassen.
Wo lagen die größten Herausforderungen?
Philipp Tengel: Am Anfang fehlen oft viele Dokumente – bei uns waren es von den angefragten 800 zunächst zwei Drittel. Da muss man dann schnell differenzieren: Was brauchen wir unbedingt, wo reicht eine Stichprobe, wo können wir mit Annahmen arbeiten? Und international wird es noch komplexer. In Indien oder China etwa ist die Datenqualität nicht immer so, wie wir sie in Deutschland gewohnt sind. Da kommt es auf Plausibilisierung an: Stimmen die Zahlen in sich, passen Bewegungsdaten zu Beständen, lässt sich die Liquidität nachvollziehen?
Nelson Donovan: Man kann nicht überall Teams vor Ort einsetzen – das würde den Prozess verlangsamen und verteuern. Deshalb arbeiten wir zentral so weit wie möglich mit den vorliegenden Daten und ziehen lokale Spezialist:innen nur hinzu, wenn es wirklich notwendig ist. Es ist wichtig, zentral einen Überblick zu haben und sich auf die Stellschrauben, die direkten Einfluss auf die Bewertung haben zu konzentrieren.
Welche Themen standen besonders im Fokus?
Philipp Tengel: Wir kannten die Branche gut, aber zwei Themen waren für uns neu: Zum einen die Tiefe der Produktion – also wie die Wertschöpfung über die Standorte verteilt ist, wo Engpässe bestehen und welche Kapazitäten realistisch verfügbar sind. Gutachten und um die Frage, wie sensibel Annahmen auf Zinsen oder Demografie reagieren.
Nelson Donovan: Gerade bei globalen Targets darf man die einzelnen Kennzahlen nicht isoliert betrachten, sondern muss prüfen, ob sie zusammenpassen: Liefert die Produktion, was die Vertriebspläne versprechen? Stimmen Margen und Zahlungsstrukturen?
Gerade große Anzahlungen oder offene Forderungen können ein Risiko sein, wenn sie nicht sauber abgesichert sind. Gleichzeitig kann man dort aber auch Verhandlungsspielräume gewinnen – zum Beispiel über Kaufpreisanpassungen oder Covenants, also vertragliche Regeln, mit denen bestimmte Risiken abgesichert werden können.
Wie sah der konkrete Zeitablauf aus?
Philipp Tengel: Der Kick-off mit KPMG war Anfang September. Mitte Oktober hatten wir die Due Diligence abgeschlossen – also in etwa sechs Wochen. Parallel haben wir an Finanzierung und Vertragswerken gearbeitet. Wichtig war, dass die Ergebnisse der Due Diligence rechtzeitig in die Unterlagen fürs Bankenkonsortium eingeflossen sind. Ohne belastbare Zahlen hätten wir die Finanzierung nicht sichern können. Am 1. Dezember haben wir schließlich unterschrieben. Das war ambitioniert, aber wir haben es geschafft.
Welche Ergebnisse haben die Kaufentscheidung und den Preis beeinflusst?
Philipp Tengel: Das Wichtigste: Es gab keine Showstopper. Aber wir haben einige Themen identifiziert, die den Preis beeinflusst haben. Zum Beispiel die Forderungsstruktur, die größeren Anzahlungen, die Pensionsgutachten und auch geplante Restrukturierungsmaßnahmen. Das hat sowohl auf das Ergebnis als auch auf den Multiplikator eingezahlt. Entscheidend war, dass wir diese Punkte früh auf dem Tisch hatten – so konnten wir sie in die Verhandlungen einbringen und den Preis entsprechend justieren.
Nelson Donovan: Es ist immer besser, wenn solche Themen sechs Wochen vor dem Signing diskutiert werden – und nicht erst zwei Stunden vorher. Hier hat die frühe Transparenz geholfen, dass sowohl Käuferseite als auch Finanzierungspartner eine klare Grundlage hatten.
Was war an der Zusammenarbeit besonders überzeugend?
Philipp Tengel: Zum einen die Geschwindigkeit: Das Team war sehr schnell, Fragen wurden sofort adressiert. Zum anderen die Tiefe: Es ging nicht darum, möglichst viele Seiten Papier zu produzieren, sondern die wirklich relevanten Themen klar und verständlich zu benennen. Für uns war das sehr wertvoll, weil wir intern parallel viele andere Themen stemmen mussten. Die Kombination aus Tempo und Tiefe hat dafür gesorgt, dass wir jederzeit das Gefühl hatten: Wir wissen, wo wir stehen.
Welche Lehren zieht man aus diesem Projekt für künftige Transaktionen?
Philipp Tengel: Jede Transaktion ist anders – es gibt immer Überraschungen. Aber der Ablauf hier war sehr nah an einer Blaupause: klarer Kick-off, kurze Abstimmungsschleifen, konsequente Priorisierung der kritischen Punkte, gute Dokumentation für Banken und Gremien. Gleichzeitig muss man flexibel bleiben. In diesem Fall waren Pensionen und internationale Datenqualität die großen Themen. Beim nächsten Mal können es andere sein – vielleicht Umweltauflagen, vielleicht IT-Systeme. Wichtig ist, ein strukturiertes Grundgerüst zu haben, das man je nach Deal anpasst.
Welche Schritte sollten Unternehmen beachten, die vor einer Akquisition stehen?
Nelson Donovan: Erstens: Die Commercial Rationale prüfen: Passt das Target zu Größe, Markt, Produkt und Integration? Wenn das nicht überzeugend ist, lohnt sich auch keine Due Diligence. Zweitens: Den Mut zum Nein behalten. Auch wenn schon Kosten angefallen sind – wenn Preis oder Risiken nicht stimmen, ist es besser, den Deal abzubrechen. Drittens: kurze Entscheidungswege schaffen. Klare Verantwortlichkeiten, schnelle Schleifen und disziplinierte Kommunikation machen den Unterschied, ob eine Transaktion in sechs Wochen oder in zwölf Monaten über die Bühne geht.