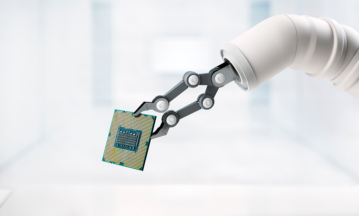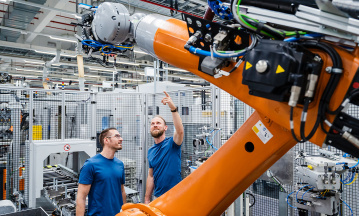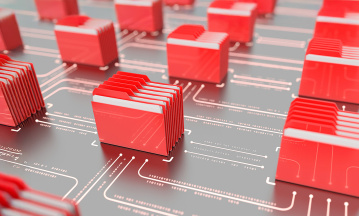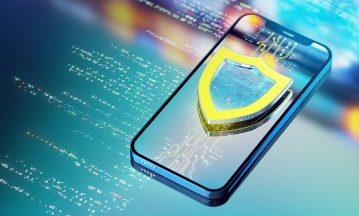Keyfacts:
- Der Koalitionsvertrag versteht Verteidigung nicht mehr nur als staatliche Aufgabe, sondern als wirtschaftlich relevantes Feld – insbesondere für Industrie, IT, Bau und Logistik.
- Software-Defined Defence ist ein Gamechanger: Mit dem Fokus auf kontinuierlich weiterentwickelbare Softwarekomponenten entsteht ein neues Ökosystem aus Bundeswehr, Industrie und Tech-Unternehmen.
- Marktverfügbare, europäische Verteidigungstechnologien sollen künftig bevorzugt beschafft werden.
Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung schafft die Grundlage für einen Veränderungsprozess in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands ist unmittelbar verknüpft mit industrieller Innovationskraft, baulicher Umsetzungsgeschwindigkeit und digitaler Resilienz. Daher sollten Führungskräfte Verteidigung nicht länger nur als staatliches Aufgabengebiet betrachten, sondern als relevanten Markt für die Geschäftstätigkeiten zahlreicher Unternehmen.
Von der Rhetorik zur Umsetzung: Die neue Realität der Verteidigungspolitik
Aus verteidigungspolitischer Sicht steht das Bekenntnis zu den NATO-Fähigkeitszielen im Zentrum des Koalitionsvertrags. Diese Zusage klingt auf dem Papier vertraut, doch ist die Stoßrichtung so entschlossen wie selten zuvor. So soll der Substanzaufbau der Bundeswehr deutlich vorantreiben werden: materiell, personell und organisatorisch. Doch was bedeutet das konkret?
Die Grundlagen für eine bessere materielle Versorgung wurden bereits mit der Aufhebung der Schuldenbremse für den Verteidigungshaushalt gelegt. Anders als beim Sondervermögen stehen nun jährlich wiederkehrende Mittel zur Verfügung, um Beschaffungsprojekte und Großvorhaben umzusetzen. Wichtig dabei: Der Koalitionsvertrag sieht für sogenannte Leuchtturmprojekte neue Realisierungsmodelle wie beispielsweise Agenturlösungen vor. So sollen bestimmte Vorhaben aus der klassischen Beschaffungsbürokratie herausgelöst und in höherem Tempo umgesetzt werden. Ein Ansatz, der Unternehmen im Entwicklungs- und Fertigungsumfeld direkte Beteiligungsmöglichkeiten bietet.
Ein Paradigmenwechsel mit Signalwirkung: Software-Defined Defense
Ein im Vertragstext unscheinbar gehaltener, aus meiner Sicht allerdings überaus bedeutender Punkt ist das Bekenntnis zu Software-Defined Defense. Der Begriff steht für einen massiven Wandel im Rüstungsverständnis und macht Schluss mit der Einstellung: einmal gekauft, für immer genutzt. Besonders die Softwarekomponenten moderner Verteidigungstechnologien müssen sich fortlaufend weiterentwickeln.
Zum Umsetzen dieses Vorhabens braucht es ein funktionierendes Ökosystem zwischen Bundeswehr, Beschaffungsstellen, Industrie und Softwareanbietern. Das hat auch die Regierung erkannt, wie der Koalitionsvertrag zeigt. Auch, wenn sich im Koalitionstext keine konkreten Angaben finden, wie ein solches Ökosystem künftig aussehen wird, ist allein die Tatsache bemerkenswert, dass die Notwendigkeit dafür thematisiert wird. Unternehmen aus den Bereichen KI, Cloud, Cybersicherheit und unbemannte Systeme sollten schon jetzt genau prüfen, wo sie hier ihre Rolle sehen. Denn wer sich zu spät positioniert, läuft Gefahr, nicht mehr Teil des Ökosystems, sondern bloßer Zulieferer zu sein.
Beschaffung: schnell, marktverfügbar, europäisch
In der Beschaffung setzt der Koalitionsvertrag auf marktverfügbare Lösungen, was nicht als reine Budgetmaßnahme missverstanden werden sollte. Tatsächlich zeigt sich hier nämlich ein neuer strategischer Realismus, weil Deutschland kurzfristig einsatzfähige eigene, zumindest aber europäische Systeme benötigt. Europäische Anbieter rücken also in den Disziplinen Forschung, Entwicklung, aber vor allem Bereitstellung marktverfügbarer Lösungen deutlich in den Fokus. Einerseits, weil der Zugang zu US-Systemen sich durch die aktuelle Regierung immer schwieriger gestalten wird. Andererseits, weil europäische Förderprogramme wie etwa der European Defence Fund gezielt multinationale Kooperationen unterstützen. Unternehmen, die sich jetzt europäisch vernetzen, Partnerschaften aufbauen und in Modularität investieren, können sich Vorteile bei der Vergabe künftiger Projekte verschaffen.
Infrastruktur: Die Rückkehr zur militärischen Einsatzfähigkeit
Die Verteidigungsfähigkeit eines Landes hängt nicht nur von den materiellen Voraussetzungen ab. Auch die Fähigkeit, Truppen im Inland mobil zu halten, ist zentral für einen ausreichenden Abschreckungseffekt, der das Ziel sämtlicher Maßnahmen ist, die zur Verteidigung im Koalitionsvertrag festgehalten wurden. Entsprechend liegt ein weiterer Fokus auf dem Ausbau militärischer Infrastruktur. Konkret bedeutet das: Brücken sollen wieder als Truppenwege nutzbar gemacht werden, Parkflächen entlang von Autobahnen für Truppenverlegungen verfügbar sein und Genehmigungen für Rechenzentren der Bundeswehr weitaus schneller als bislang erteilt werden. Aus diesen Gründen soll die Bundeswehr künftig eigene Bauprojekte ohne Umweg über Landesbehörden durchführen können. Das eröffnet eine neue Auftragslage vor allem für Bau-, Planungs- und Logistikunternehmen, die bereits Erfahrung im sicherheitsrelevanten Umfeld mitbringen.
Personelle Stärkung: Der Wehrdienst als organisatorisches Comeback
Nicht zuletzt muss die Bundeswehr ihre personelle Basis sichern. SPD und Union wollen ein Wehrdienstmodell einführen, das sich an dem Schwedens orientiert und auf Freiwilligkeit basiert. Allerdings halte ich es für absehbar, dass aus diesem Model mittelfristig ein verpflichtender Wehrdienst werden könnte, was konkrete Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hätte. Unternehmen, die junge Nachwuchskräfte rekrutieren wollen, sollten für deren Arbeitseintritt aufgrund des Wehrdienstes mit einem Jahr Verzögerung rechnen.