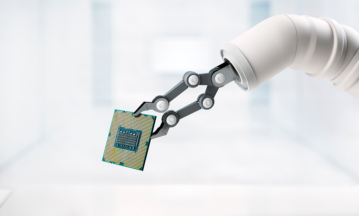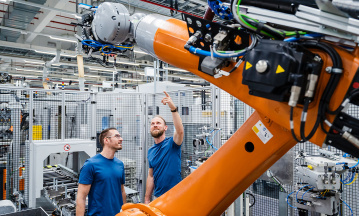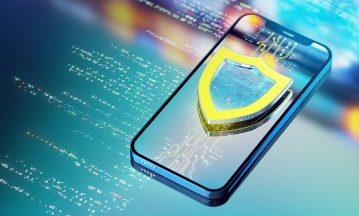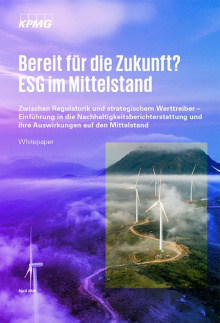Die Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche – und sind doch in vielen ESG-Strategien kaum sichtbar. Dabei spielen sie eine zentrale Rolle für die Stabilität unseres Planeten: Sie absorbieren rund 25 Prozent der vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen und produzieren mindestens 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir atmen. Gleichzeitig bilden sie die Lebensgrundlage für Millionen von Menschen – nicht nur durch Fischerei, sondern auch als globale Transportwege oder Tourismusquelle.
Doch die Weltmeere sind bedroht. Steigende Temperaturen, zunehmende Versauerung, Mikroplastik und Übernutzung gefährden marine Ökosysteme laut den UN in alarmierendem Tempo.
Ökologische Risiken und ökonomischer Druck
Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht weniger spürbar als der ökologische. Die globale Ozeanwirtschaft hat sich laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in den letzten 25 Jahren real verdoppelt und erreicht mittlerweile einen Wert von 2,6 Billionen US-Dollar. Haupttreiber waren Tourismus sowie Offshore-Öl- und Gasförderung. Doch auch neue Sektoren wie Meeresbiotechnologie, Offshore-Windkraft und Elektrotechnik entwickeln sich zunehmend.
- Die Meeresbiotechnologie wächst stark: Der Markt soll von 7 Milliarden US-Dollar (2024) auf über 11 Milliarden US-Dollar (2032) steigen. Sie findet Anwendung in Lebensmitteln, Medizin, Kosmetik und Nahrungsergänzung und fördert Innovation, etwa durch EU-Projekte wie NOMORFILM, das antibiotische Wirkstoffe aus Mikroalgen patentiert.
- Aquakultur hat großes Potenzial: Der globale Verkaufswert aquatischer Tiere liegt bei 453 Milliarden US-Dollar. Mit wachsender Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln, wie beispielsweise Garnelen, Tilapia, Austern, wächst der Markt, bleibt aber in vielen Regionen – etwa Teilen Afrikas – unterfinanziert.
- Erneuerbare Offshore-Energien wie Wind-, Wellen- und Gezeitenkraft nehmen zu. Offshore-Wind allein könnte bis 2050 jährlich 4,5 Gigatonnen O₂ einsparen und wirtschaftlich bis zu 6,8 Billionen US-Dollar bringen. Dennoch besteht eine jährliche Investitionslücke von über eine Billion US-Dollar – der Handlungsbedarf ist hoch.
Ozeanwirtschaft: Unternehmen in der Verantwortung
Immer mehr Unternehmen erkennen: Ihre Geschäftsmodelle sind direkt oder indirekt vom Zustand der Ozeane abhängig. Die maritime Lieferkette, die Verfügbarkeit von Rohstoffen oder der Schutz küstennaher Standorte – all das hängt mit dem Meer zusammen.
Zugleich wächst der Druck von außen: Investoren, Aufsichtsbehörden und Verbraucher fordern zunehmend Transparenz über die Auswirkungen unternehmerischen Handelns – auch unter Wasser. Das bedeutet: ESG-Berichterstattung wird künftig auch den Zustand der Ozeane abbilden müssen.
Daten als Schlüssel zum Schutz der Ozeane
Ein zentrales Hindernis für wirksames Handeln ist laut der UN noch immer der Mangel an verlässlichen Daten. Viele Meeresregionen sind wissenschaftlich kaum erfasst, Umweltveränderungen bleiben oft lange unbemerkt. Für Unternehmen, die ESG messbar machen wollen, ist das ein Problem. Fortschritte in der Sensorik, Satellitenbeobachtung und künstlichen Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten – etwa zum Verfolgen von Schiffsbewegungen, Erkennen von Schadstoffeinträgen oder der Analyse von Biodiversitätsverlusten.
Um solche Fortschritte zu ermöglichen, braucht es Partnerschaften zwischen Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft. KPMG ist daher eine strategische Partnerschaft mit dem Hochsee-Segelteam Malizia eingegangen, um so das Erheben mariner Umweltdaten in schwer zugänglichen Regionen zu unterstützen. Während globaler Regatten erfasst das Team unter anderem CO₂-Konzentrationen, Wassertemperaturen und Salzgehalte – und leistet so einen wertvollen Beitrag zur Klimaforschung. Diese Daten schaffen auch für Unternehmen die Grundlage, ihre ESG-Ziele entlang der gesamten Wertschöpfungskette fundiert zu steuern.
Potenziale der „Blue Economy“ nutzen
Für Unternehmen ergeben sich aus der Bedeutung der Ozeane klare Handlungsfelder. Entscheidend ist, ihre Rolle nicht nur im Rahmen der Risikobetrachtung zu erfassen, sondern den strategischen Mehrwert aktiv zu nutzen. Die sogenannte „Blue Economy“ bietet erhebliche Potenziale – etwa durch Investitionen in nachhaltige maritime Infrastrukturen, den Einsatz innovativer Technologien oder das gezielte Unterstützen wissenschaftlicher Projekte.
Wer ozeanbezogene Maßnahmen in seine Klima- und Geschäftsstrategien integriert, kann damit einen doppelten Nutzen erzielen: zur CO₂-Kompensation beitragen und gleichzeitig messbare naturpositive Effekte bewirken. Bildung, Forschung und eine transparente Kommunikation schaffen zusätzlich die notwendige Sichtbarkeit und stärken die ESG-Glaubwürdigkeit.
Unternehmen, die ozeanbezogene Aspekte frühzeitig und systematisch in ihre Nachhaltigkeitsstrategie einbauen, erhöhen ihre regulatorische Resilienz, sichern Investorenvertrauen und schaffen langfristig belastbare Werte.