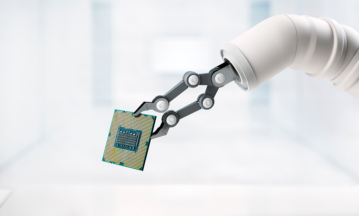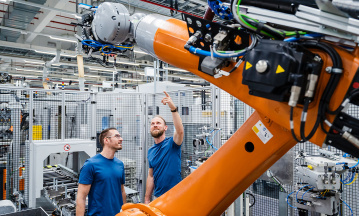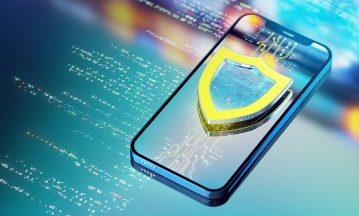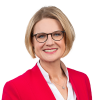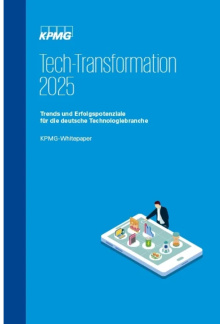Keyfacts:
- Die Initiative ist ein erster mutiger Schritt, um einen neuen Businessplan für das Land aufzusetzen.
- Während Großunternehmen vorangehen, wird der Mittelstand von Folgeaufträgen profitieren.
- Doch Bürokratieabbau, Fachkräftezuwanderung und ein mentaler Wandel sind nötig, damit aus Ankündigungen Projekte werden.
Das richtige Signal zur exakt richtigen Zeit. So lässt sich aus unserer Sicht die Investitionsinitiative „Made for Germany“ kurz und bündig bewerten, im Zuge derer sich jüngst 61 Unternehmen zu Investitionen in Höhe von 631 Milliarden Euro bereiterklärt haben. Das Ziel: Deutschland als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu stärken.
Denn Deutschland befindet sich aktuell in einer Situation, in der mutige Schritte notwendig sind. Auf der einen Seite stehen wir als Wirtschaftsstandort trotz allen Wehklagens noch immer vergleichsweise stabil da. Der Aktienmarkt ist solide, die Notenbank unabhängig, die Staatsfinanzen geordnet. Die strukturelle Basis ist durchaus intakt. Wahr ist aber auf der anderen Seite auch, dass diese Lage alles andere als gesichert ist, weil wichtige Industriebranchen technologisch aufholen müssen und der drohende Zolldruck viele Unternehmen in echte Bedrängnis bringen kann.
Damit die wirtschaftliche Leistungskraft Deutschlands trotz der Veränderungen durch schnellen technologischen Fortschritt und geopolitische Verschiebungen auf dem aktuellen Niveau bleiben oder im besten Fall weiter steigen kann, muss viel passieren. Erste Schritte dieses Richtungswechsels sind mit dem Sondervermögen und der Investitionsoffensive jetzt vollzogen.
Fehlstart für den Mittelstand? Keinesfalls
Dass die Initiative auch Kritik auf den Plan ruft, ist nur natürlich und richtig. Allerdings greift insbesondere die Anmerkung, dass der Mittelstand noch kaum beteiligt sei, was die Initiative entwerten würde, aus mindestens drei Gründen zu kurz.
Erstens: Die Initiative ist als ein Anfang zu verstehen. Ursprünglich waren es 31 Unternehmen, die sich unter dem Label „Made for Germany“ versammelt haben, nun sind es bereits 61, was die Sogwirkung zeigt und nahelegt, dass sich weitere anschließen werden.
Zweitens: Der Mittelstand wird von neuen Aufträgen, dem Ausbau der Infrastruktur sowie Investitionen in Energie, Bau und Verteidigung signifikant profitieren – denn die Initiative wird Großaufträge erteilen, stärkt das Vertrauen in den Standort und steigert dadurch insgesamt seine Attraktivität.
Drittens: Die Beteiligung ist kein Selbstzweck. Entscheidend ist, dass nun Investitionen getätigt werden,Vertrauen entsteht und ein wirtschaftlicher Turnaround gelingt. Wenn die Rahmenbedingungen sich verbessern, steigt auch die Beteiligung.
Vertrauen lässt sich nicht verordnen: Was die Unternehmen von der Politik erwarten
Womit wir bei den Erwartungen der Unternehmen an die Politik sind. Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden. So sollten Windparks in acht Monaten realisierbar sein und dürfen nicht wie noch vor Kurzem unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern acht Jahre dauern. Es braucht schnelle und verbindliche Förderzusagen und eine klare Linie in der Energiepolitik.
Unternehmen können nicht in Milliardenprojekte investieren, wenn Anreize, Regulierungen oder Gesetze ständig angepasst werden. Vertrauen entsteht nur durch einen stabilen Rahmen und eine verlässliche Umsetzung. Deswegen lohnt auch kein Blick zurück, ob bestimmte Maßnahmen revidierbar sind oder richtig waren. Die Bundesregierung startet nun auf Basis der heutigen Verhältnisse und hat im Koalitionsvertrag den Rahmen gegeben.
Der vergessene Hebel: Europäischer Binnenmarkt
Das sind die Hebel, die gerade viel diskutiert werden. Oft vergessen wird allerdings der Punkt: europäischer Binnenmarkt. Während der Blick oft nach Übersee geht, liegt ein entscheidender Hebel für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit direkt vor der Haustür. Doch obwohl der europäische Binnenmarkt 450 Millionen Menschen umfasst, ist er in der Praxis weit weniger offen, als es auf dem Papier scheint.
Zwischen den Mitgliedsstaaten bestehen insbesondere im Dienstleistungsbereich weiterhin zahlreiche Handelshemmnisse. Umgerechnet entsprechen sie teils einem Zollniveau von bis zu 40 Prozent. Dieses Potenzial wird bislang kaum genutzt, auch medial bleibt es erstaunlich still.
Dabei wäre der Abbau dieser Schranken ein sofort wirksamer Konjunkturimpuls. Und das nicht durch neue Ausgaben, sondern durch bessere Nutzung bestehender Strukturen. Für einen Standort wie Deutschland, der auf offenen Märkten und hoher Spezialisierung beruht, ist ein funktionierender Binnenmarkt nicht nur wünschenswert, sondern mehr denn je notwendig. Wer über Standortpolitik spricht, darf Europa nicht ausblenden. Auch müssen in anderen europäischen Ländern ähnliche Investitionsbekenntnisse für Europa folgen.
Papierformulare, Planungsstaus, Personallücken: Wo es jetzt klemmt
Eine weitere Forderung, die die Unternehmen an die Politik haben, ist der Bürokratieabbau. Auch hier wollen wir das Augenmerk auf Aspekte legen, die aus unserer Sicht zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Dazu gehört unter anderem die Digitalisierung von Antragsprozessen. Wenn Investoren auf Papierformulare, lange Wege und Schnittstellenprobleme treffen, wird jedes Innovationssignal deutlich geschwächt.
Auch die Vereinheitlichung von Genehmigungsstandards zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist dringend notwendig, um Projekte schneller und rechtssicher umsetzen zu können. Das ist nichts Neues und leicht zu fordern. Wir sehen bereits erste Entwicklungen und arbeiten an diesen mit.
Besitzstände überdenken
Mut zeigt sich nicht im Aufbruch allein, sondern im Verzicht auf das Vertraute. Unser klarer Appell lautet: „Besitzstände blockieren vielerorts auch Veränderung.“ Sei es das eigene Krankenhaus in jeder Kleinstadt oder das Stadtwerk als Prestigeprojekt eines Bürgermeisters. Wenn aus der Symbolik Veränderung werden soll, braucht es einen mentalen Wandel. Das gilt auch für ESG-Richtlinien. Die Omnibus-Verordnung war ein Schritt in die richtige Richtung, aber es braucht weitere Vereinfachungen, etwa bei der Berichterstattung oder der Auslegung von Berichtspflichten.
Ein zentraler Punkt, damit aus angekündigten Investitionen echte Vorhaben werden, ist der Zugang zu Fachkräften – und der sollte dringend vereinfacht werden. Dazu gehören unbürokratischere Anerkennungsverfahren für ausländische Abschlüsse, beschleunigte Visa-Prozesse für Schlüsselkräfte und eine aktivere Vermittlung zwischen Unternehmen und internationalen Talenten. Ohne eine stabile Personalbasis werden auch die besten Investitionsprogramme ins Leere laufen.
Ein Anfang für ein „Neues Geschäftsmodell Deutschland“ ist gemacht
Das traditionelle deutsche Geschäftsmodell – exportgetrieben, energiekostengünstig und fokussiert auf industrielle Produktion – ist unserer Meinung nach nicht mehr tragfähig. Die künftige Stärke dieses Landes liegt deshalb nicht darin, dass wir an unserem Status als kompromissloser Exportchampion festhalten, sondern überlegen, in welchen Bereichen wir künftig führend werden wollen. Kurz gesagt: Deutschland braucht einen neuen Businessplan.
So sind vielerlei Innovationen zu beobachten, die unseren Status als Weltmarktführer weiter untermauern werden. Ein Beispiel für diese Entwicklung liefert die Zusammenarbeit eines Gesundheitsdienstleisters und eines Automobilherstellers: In Fahrzeugen erfassen Sensoren Gesundheitsdaten in Echtzeit, etwa am Lenkrad, Sitz oder Schalthebel. Die Daten werden in Echtzeit ausgewertet und können Leben retten, wenn Unregelmäßigkeiten erkannt und direkt mitgeteilt werden.
Dieses Zusammenspiel von Medizintechnik, Mobilität und Datenintegration zeigt, wie neue Formen von neuen Industriezweigen und damit Wertschöpfung entstehen. Solche Kooperationen stehen exemplarisch für eine Industrie, die aus Traditionen durch technologische Entwicklungen bahnbrechende Innovationen schafft.
Momentum erhalten
Wenn, angestoßen durch „Made for Germany“, staatliches Kapital jetzt gezielt mit privatem Geld kombiniert wird, wird daraus ein echter Richtungswechsel für Deutschland und Europa entstehen. Entscheidend ist jetzt jedoch, dass keine Seite in eine reine Erwartungshaltung verfällt und abwartet. Stattdessen sollte das Momentum durch klare Signale aufrechterhalten werden: durch Kapital auf der einen Seite sowie durch verbesserte Planbarkeit und beschleunigte Umsetzung auf der anderen. Dass die Industrie den angebotenen Schulterschluss mit der Politik nun eingeht, ist ein sehr positives Signal.