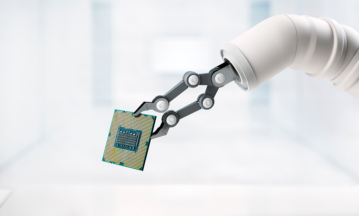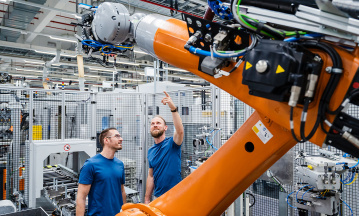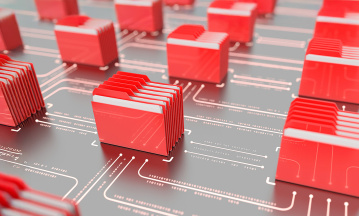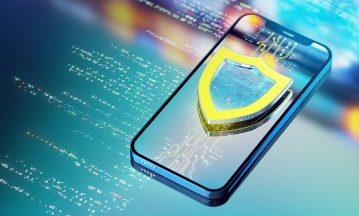Keyfacts:
- Auslöser für Wandel in kommunalen Unternehmen wie Stadtwerken ist häufig Druck von außen.
- Die zunehmende Dezentralität der Stromversorgung stellt Stadtwerke von Herausforderungen, denen sie allerdings gerade durch die eigene dezentrale Struktur begegnen können.
- Wer digitale Transformation grundlegend angeht, das mittlere Management einbindet und Kommunikation auf Transparenz und Klarheit ausrichtet, positioniert sich gut für den Wandel.
In der Energiewirtschaft wurden zentrale Entwicklungen in den vergangenen Jahren nicht ausreichend vorangetrieben. Das gilt insbesondere für den Netzausbau und die Digitalisierung. Ein wesentlicher Grund hierfür ist aus meiner Sicht, dass viele Unternehmen in öffentlicher Hand sind, wo Veränderungen nicht proaktiv erfolgen, sondern häufig erst dann stattfinden, wenn externer Druck entsteht. Eines der wichtigsten und nicht mehr zu ignorierenden Transformationsfelder, das einen solchen Druck ausübt, ist derzeit die zunehmende Dezentralisierung der Energieversorgung.
Warum Stadtwerke jetzt aktiv werden sollten
Durch eine wachsende Anzahl an sogenannten „Prosumern“, gerät das Geschäftsmodell vieler Stadtwerke in Bedrängnis. Prosumer verbrauchen nicht nur Energie, sondern erzeugen auch welche – etwa durch Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke oder andere dezentrale Technologien. Diese doppelte Rolle verändert die klassische Struktur der Energiewirtschaft grundlegend: Statt Erzeuger auf lokaler Ebene gibt es zunehmend viele kleine, lokal agierende Einheiten, die ebenfalls Strom ins Netz einspeisen. Das macht neue Anforderungen an Netzinfrastruktur, Marktmodelle und regulatorische Rahmenbedingungen nötig.
Dieser Wandel wurde von den Stadtwerken lange Zeit ignoriert, weil es besonders kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu komplex und zu aufwendig erschien, ihr Geschäftsmodell entsprechend anzupassen. Vielen wird nun aber klar, dass weitere Verzögerungen gerade für sie existenzbedrohend sein können. In der kommenden Zeit werden wir deshalb meiner Meinung nach einige Kooperationen und Fusionen erleben, weil die heutige Fragmentierung mit rund 900 Verteilnetzbetreibern und über 800 Stadtwerken langfristig kaum tragfähig sein wird.
Wie Dezentralität zu einer Stärke wird
Doch liegt in der Dezentralität der aktuellen Stadtwerkelandschaft trotz der problematischen Aspekte auch eine Stärke. Konkret: Stadtwerke sind regional verankert und kennen die politischen Verhältnisse vor Ort, was in einer zunehmend instabilen Welt ein Vorteil sein kann. Es sorgt für eine Resilienz, die viele Strombetreiber nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht hatten. Während „First Mover“ im Stromhandel teils gravierende Verluste hinnehmen mussten, haben viele kommunale Versorger solide gewirtschaftet. Das spricht für Augenmaß und muss nicht zwangsläufig etwas mit Stillstand zu tun haben.
Drei Transformationshemmnisse, die sich vermeiden lassen
Dennoch ist es wichtig, dass sich Stadtwerke nach innen agiler aufstellen und veränderungsfreundlicher werden. Folgende drei Punkte stehen meiner Erfahrung nach jedoch häufig erfolgreicher Transformation im Wege:
Erstens: Ein IT-Projekt macht noch keine digitale Transformation
Der vielerorts dringend benötigte Wandel darf nicht darin bestehen, dass IT-Projekte vorschnell als Digitalisierungsinitiativen verstanden werden, in der Hoffnung, dass sich bestehende Prozesse den neu eingeführten Systemen schon anpassen. Technologie ist ein wichtiger Teil, führt ohne einen Kulturwandel des gesamten Unternehmens allerdings höchstens zu Verdruss.
Zweitens: „Kleine Königreiche” des mittleren Managements mitnehmen
Die Belegschaft ist in Veränderungsprozessen nur selten der bremsende Faktor, denn die meisten Mitarbeitenden wissen sehr genau, wo es im Alltag hakt. Wirklich schwieriger ist es, neue Routinen in die Führungsetagen zu tragen. Gerade im mittleren Management, in funktional abgeschotteten Strukturen oder historisch gewachsenen Abteilungen, die nicht selten „kleinen Königreichen” ähneln, kommt der Wandel oft nur langsam voran. Was über Jahre hinweg gut funktioniert hat, wird plötzlich infrage gestellt. Das führt zu Unsicherheit und Verlustängsten. Genau hier entscheidet sich jedoch, ob Veränderung gelingt.
Drittens: Kommunikation ist nicht alles. Aber ohne klare Kommunikation ist alles nichts
Ob eine Initiative langfristig Wirkung entfaltet, hängt zudem nicht nur von den passenden Kennzahlen und Tools ab. Entscheidend ist es, ein Umdenken zu ermöglichen, das den Blick mehr auf künftige Chancen statt auf bestehende Zuständigkeiten richtet. Dazu gehört auch eine gute Kommunikation. Das bedeutet, zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Maß Klarheit zu schaffen. Nicht zu früh. Nicht zu viel. Aber transparent und ehrlich.
Was jetzt zählt
Stadtwerke stehen vor der Herausforderung, ihre Stärken in Dezentralität und regionaler Verankerung mit einem klaren strategischen Vorgehen zu verbinden. Denn die aktuellen Veränderungen im Energiesystem – von der wachsenden Zahl an Prosumern über neue Marktmodelle bis hin zu steigenden Anforderungen an die Netzinfrastruktur – lassen sich mit den bisherigen Strukturen nicht mehr bewältigen. Transformation beginnt dabei nicht mit Technologie allein, sondern mit der Bereitschaft zu Veränderung in der Führung und der Kommunikation.