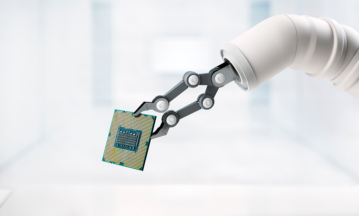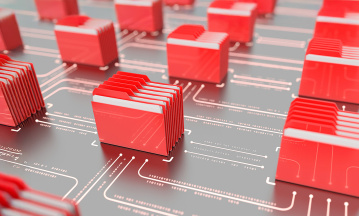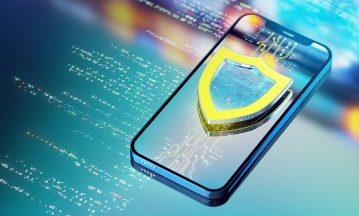Wie sind Startups und die öffentliche Verwaltung konstruktiv zusammenzubringen? Diese Frage wird aktuell vielerorts diskutiert – nicht nur, weil im öffentlichen Sektor von etlichen Beobachtern Innovationsdefizite hinsichtlich neuer Technologien ausgemacht werden. Das Einrichten sogenannter Startup-Hubs ist ein Lösungsansatz, der für beide Seiten bedeutend sein kann. Hintergründe und konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten haben wir in unserem kompakten Policy Paper aufgezeigt. Details zu den Chancen, Risiken und einzelnen Erfolgsfaktoren erklären die Autoren des Whitepapers, Dr. Ferdinand Schuster, Geschäftsführer des von KPMG geförderten Instituts für den öffentlichen Sektor, und Benjamin Wolf-Engels, Projektmanager des Instituts, im Interview.
Kompakt vorab: Was versteht man genau unter einem Startup-Hub?
Ferdinand Schuster: Das ist eine Stelle, Abteilung oder Einheit in der öffentlichen Verwaltung, die mit einer Person – oder mehreren Personen – mit Startup- und Verwaltungsfachkenntnissen besetzt ist. Sie wissen um die Eigenheiten beider Parteien gleichermaßen. Der Hub als Kontaktstelle bahnt Jungunternehmen den Weg in die Welt des öffentlichen Sektors, der wiederum von der Innovationskraft der neuen Partner profitieren kann.
Warum können die Startup-Hubs gerade für die Verwaltung ein besonderer Innovationstreiber sein? Wo liegen die Potenziale beim niedrigschwelligen Andocken?
Benjamin Wolf-Engels: Der öffentliche Sektor gerät wegen des Fachkräftemangels zunehmend unter Druck, seine Aufgaben und Funktionen vollumfänglich zu erfüllen. Externe Unterstützung, beispielsweise bei der Automatisierung von Prozessen und somit der Entlastung personeller Ressourcen, ist daher wichtig. Der Verwaltung fällt es zudem oftmals schwer, neue Ideen zur Problemlösung zu entwickeln. Startups können Impulse von außen geben – wenn man sie lässt. Das Ziel in der Praxis ist es, Bürgerinnen und Bürgern mit Unterstützung der Startups bessere Leistungen anzubieten. Um das zu ermöglichen, ist es maßgeblich, Barrieren zwischen Startups und Verwaltung abzubauen.
Gibt es bereits Beispiele für diese erfolgreiche Zusammenarbeit?
Ferdinand Schuster: Bei unserer Veranstaltung „myGovernment“ hat sich vor ein paar Jahren die sächsische Kleinstadt Heidenau mit ihrem gemeinsamen Projekt Little Bird präsentiert. Das ist eine Online-Plattform, die für Eltern die Anmeldung bei Kindergärten und für die Verwaltung die Kindergartenplatzvergabe vereinfacht. Die Lösung wurde von der Gründerin entwickelt, weil die zuständige Heidenauer Amtsleiterin mit dem Anmeldeprozess für die städtischen Kindergärten nicht zufrieden war: Mehrfachanmeldungen, Wartezeiten und Intransparenz wurden beklagt. Die aus der Anfrage resultierende Innovationspartnerschaft wurde zu einem großen Erfolg. Aus dem Programm entstand ein Startup und aus dem Startup ein mittlerweile beachtliches Unternehmen. Hunderte deutsche Städte haben Little Bird mittlerweile im Einsatz.
Welche Hürden sind von beiden Seiten für solche eindrucksvollen Ergebnisse zu nehmen?
Benjamin Wolf-Engels: Auf Seiten der Verwaltung gibt es Vorbehalte, weil ihrer Ansicht nach bei wenig erprobten Produkten von Startups die Rechtssicherheit fehlt. Das sorgt für Unsicherheit und führt zu der Sorge, dass Projekte womöglich scheitern. Eine gering ausgeprägte Risikofreudigkeit der Verwaltung bestätigt sich immer wieder in unseren Umfragen. Außerdem ist auch die meist eher geringe generelle Erfahrung bei der Arbeit mit Startups ein Hindernis. Es ist in vielerlei Hinsicht Neuland.
Ferdinand Schuster: Wir sehen häufig, dass zwei Welten aufeinanderprallen, ob hinsichtlich der Technikaffinität, der Vorgehensweise bei der Problemlösung oder auch schlichtweg hinsichtlich des Alters der Beteiligten. Startups und öffentliche Verwaltung sind gegensätzliche Pole. Diese Hürden sind aber meiner Meinung nach überwindbar.
Das heißt, ausschlaggebend für die bisher noch eher seltene Zusammenarbeit sind eher weiche Faktoren wie die unterschiedliche Unternehmenskultur?
Benjamin Wolf-Engels: Nein, es gibt auch andere Aspekte, beispielsweise rechtliche. Vergabekriterien bei Aufträgen sind in der Regel an Referenzen geknüpft. Das heißt: Die Verwaltung gibt vor, dass Bewerber erst dann den Zuschlag erhalten, wenn sie nachweisen können, dass sich ihr Lösungsansatz beispielsweise bereits fünf Mal bewährt hat. Dieser Nachweis ist für Startups nicht nur deswegen schwer zu erbringen, weil sie den Lösungsansatz womöglich erstmals präsentieren. Sie haben teils auch eine andere Herangehensweise an die Auftragserfüllung. Dann ist der Auftrag so, wie er ausgeschrieben ist, von einem jungen Unternehmen schlichtweg nicht zu erfüllen – auch wenn deren Ansatz vielleicht der erfolgsträchtigste wäre.
Ferdinand Schuster: Bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen ist es unserer Ansicht nach besonders relevant, die Verwaltung zu sensibilisieren. Die Vorgaben im Vergaberecht sind nämlich nicht so starr, wie sie in der Praxis vielfach ausgelegt werden.
Inwiefern?
Ferdinand Schuster: Nehmen wir die erwähnten Referenzen als Beispiel. Das Anfordern von Referenzen wird von der Verwaltung oftmals sehr strikt gehandhabt, aber dieser Punkt ist gesetzlich nicht zwingend . Man könnte das Vorlegen von Referenzen im Bündel der Kriterien nicht nur deutlich geringer gewichten – also statt fünf Referenzen eine einzige Referenz fordern – sondern sogar ganz darauf verzichten. Der stärkere Fokus auf den Innovationsgrad oder auf passgenaue Anwendungen mit besonderer Lösungstiefe würde für Startups Vorteile bringen.
Das Vergaberecht lässt das zu?
Ferdinand Schuster: Ja. Es ist sogar möglich, ein Problem auszuschreiben, zu dem es noch gar keine Lösung am Markt gibt. Little Bird war damals auch neu. Es existieren rechtlich sichere Spielräume, die im Sinne innovativerer Beschaffungen nutzbar sind.
Benjamin Wolf-Engels: In Hamburg gibt es jetzt zudem eine sogenannte Experimentierklausel im Vergaberecht: Bei der Ausschreibung eines Auftrags im Wert von bis zu 100.000 Euro ist es für die Verwaltung möglich, nur ein einziges Unternehmen zur Auftragsabgabe aufzufordern. Dieses innovative Prozedere ist dann anwendbar, wenn das Hamburger Startup-Hub GovTecHH, am Vergabeverfahren beteiligt ist und es um die Erprobung neuer Technologien zur Modernisierung der Verwaltung geht.
Sind diese Optionen innerhalb des Vergaberechts oder das Hamburger Beispiel nicht bekannt?
Benjamin Wolf-Engels: Entweder es fehlt das Wissen zu diesen Optionen oder es fehlt strukturell die Entschlossenheit und Risikobereitschaft, die Möglichkeiten auszuschöpfen.
Wie ist die Gesamtlage in der Praxis? Sind Transformationsprozesse sowie ein Umdenken schon gestartet?
Ferdinand Schuster: Noch nicht. Analysen zeigen, dass Startups bei Vergabeverfahren bislang wenig berücksichtigt werden. In Einzelfällen bewegt sich langsam etwas. Startup-Hubs sind im Kommen, aber sie existieren erst seit wenigen Jahren. Das Bewusstsein dafür, dass sie als ideale Schnittstelle fungieren können, bildet sich derzeit heraus. Positiv ist, dass die Bundesregierung die Chancen ebenfalls erkannt hat. Das sieht man an Großprojekten wie dem GovTech Campus Deutschland oder dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Es wäre förderlich, wenn alle größeren Behörden künftig Startup-Hubs installieren. Dafür braucht man auch nicht unbedingt eine neue Stelle zu schaffen, es könnten auch bestehende Kräfte leisten.
Das heißt: Je mehr Startup-Hubs existieren, desto größer die Sichtbarkeit und damit einhergehend niedrigschwelliger das flächendeckende Kooperationsangebot?
Benjamin Wolf-Engels: Ja, denn noch ist alles neu, auch die Vernetzung innerhalb des Startup-Hub-Ökosystems braucht Zeit. Dabei spielt nicht zuletzt die Integration in die Verwaltungsstruktur eine wesentliche Rolle. Startup-Hubs benötigen zudem mehr Inhouse-Rückendeckung als bisher. Ideal wäre eine formelle Einbindung in Prozesse. Man könnte etwa in Ausschreibungen dezidiert auf den Hub verweisen, um ihn prominent zu platzieren und somit die Außenwahrnehmung zu stärken.
Die Hubs bekommen dann auch eine große Verantwortung. Was ist bei der personellen Besetzung zu beachten?
Benjamin Wolf-Engels: Damit die Hubs die Brückenfunktion bestmöglich wahrnehmen können, arbeiten in der Praxis häufig Personen aus beiden Bereichen zusammen: Angehörige der Verwaltung und ehemalige Startup-Beschäftigte. Für diese Kombination plädieren wir auch ausdrücklich.
Warum?
Ferdinand Schuster: Weil Personen, die sich in der Startup-Szene auskennen, nicht selten mit der Verwaltung zunächst genauso fremdeln wie Verwaltungsbeschäftigte mit Startups. Wer als ehemaliger „Startupper“ jungen Unternehmen die Verwaltung erklären will, sollte entsprechende Kenntnisse haben. Die wiederum bekommt er von verwaltungserfahrenen Personen. Es gilt, beide Welten zu vereinen.
Gibt es weitere direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen, die Sie Führungskräften in der Verwaltung bezüglich Startup-Hubs mit auf den Weg geben können?
Ferdinand Schuster: Schreibt Probleme aus und nicht Lösungen. Der Hintergrund dieses plakativ wirkenden Appells: Wir stellen immer wieder fest, dass der öffentliche Sektor ungern kundtut, dass es überhaupt Probleme gibt. Oft wird dann in Ausschreibungen ausführlich dargelegt, dass diese und jene Lösung gesucht wird und dass Anbieter erklären mögen, wie sie gedenken, genau die verlangte Leistung zu erbringen. Das ist nicht immer zielführend. Man sollte lieber sinngemäß bekanntgeben: „Wir haben Problem X – bitte helft uns.“ Das gibt Chancen für wirklich neue Lösungen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Öffentlicher Sektor | Mehr zum Thema
Podcast: Fördermittel im öffentlichen Sektor erfolgreich einwerben