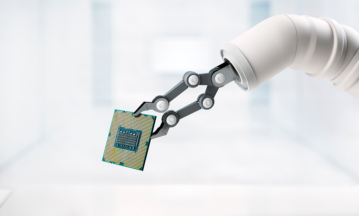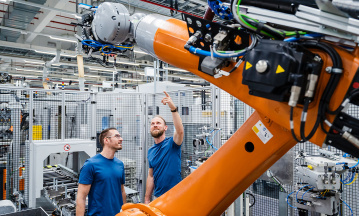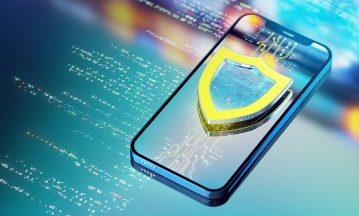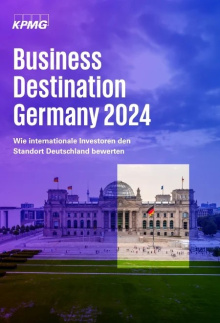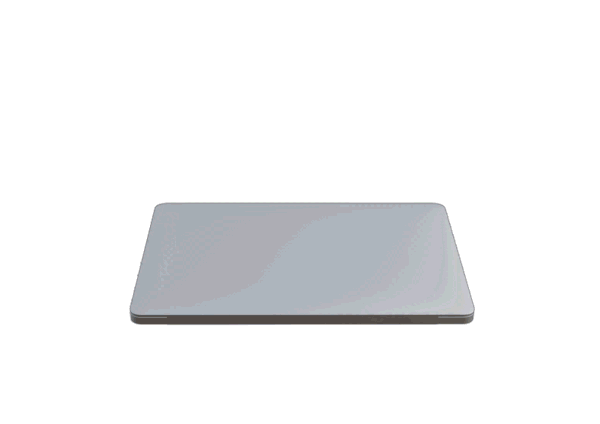Keyfacts:
- Der Vertrag führt die bestehende Energiepolitik fort, mit Anpassungen in Detailfragen.
- Ein systemischer Ausbau von Erneuerbaren, Netzen und Speichern soll Versorgungssicherheit und bezahlbare Strompreise sichern.
- Trotz ambitionierter Ziele fehlt es an klaren Konzepten für Netzstabilität, Speicherlösungen und Versorgungssicherheit bei Dunkelflauten.
Mit Spannung wurde das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen erwartet. Nun liegt es vor – doch erfüllt es die Erwartungen von Energiewirtschaft und Industrie? Ein Blick auf die zentralen Inhalte und Auswirkungen für die Energiepolitik
Die Grundprämissen: Deutschland bleibt Energieimportland – und zugleich ein starker Industriestandort. Klimaschutz gilt als Fortschrittsmotor. Der Kohleausstieg bis spätestens 2038 bleibt gesetzt. Das Bekenntnis zu einem starken Industriestandort ist ein positives Signal – es erfordert jedoch entschlossenes, stringentes Handeln.
—– —–
1. Das Wichtigste: Entlastung
Die Koalition setzt gezielt auf Entlastung: Der Wegfall der Gasspeicherumlage, die Halbierung der Netzentgelte, die Senkung der Stromsteuer auf das Europäische Mindestmaß sowie einen Industriestrompreis für kleine und mittelständische Unternehmen werden gewerbliche und private Energieverbraucher entlasten. Auch in der Wärmeversorgung bekennt sich die Koalition zu fairen und transparenten Preisen. Das sogenannte Heizungsgesetz soll nicht umgesetzt werden.
Langfristig wollen CDU, CSU und SPD international wettbewerbsfähige, planbare und dauerhaft niedrige Energiekosten durch einen systemischen Ansatz erreichen. Dieser basiert auf dem Zusammenspiel vom Ausbau Erneuerbarer Energien, einer Kraftwerksstrategie, dem gezielten und systemdienlichen Ausbau von Netzen und Speichern, höheren Flexibilitäten und einem effizienten Netzbetrieb. Ein erweitertes Energieangebot dient zudem der Stabilisierung und Reduzierung der Stromkosten.
Reservekraftwerke sollen künftig nicht nur die Versorgungssicherheit gewährleisten, sondern auch zur Stabilisierung des Strompreises dienen. Ergänzend sollen steuerliche Anreize und gesetzliche Anpassungen im Bereich der Energieeffizienz dazu beitragen, die Energieversorgung bezahlbar zu gestalten.
2. Das Top-Thema: Finanzierung
Investitionen in die Energieinfrastruktur sollen laut Koalitionsvertrag durch eine Kombination von öffentlichen Garantien und privatem Kapital abgesichert und ermöglicht werden. Zudem plant die angestrebte nächste Regierung (nun endlich) einen Investitionsfonds für die Energieinfrastruktur aufzulegen.
Erneuerbare Energien sollen sich perspektivisch vollständig am Markt refinanzieren können. Dafür ist die Schaffung eines gesicherten Investitionsrahmen vorgesehen. Auch im Bereich der Wärmeversorgung plant die Koalition Anreize für den Einsatz von privatem und öffentlichem Kapital. Darüber hinaus soll die Bundesförderung aufgestockt werden.
3. Das Zusammenspiel: Die Systemdienlichkeit
Der Umbau des Energiesystems erfolgt demnach auf Basis einer klar definierten Kraftwerksstrategie. Zentrale Maßnahme ist der geplante Zubau der lange erwarteten Backup-Gaskraftwerkskapazitäten in Höhe von 20 GW bis 2030. Ergänzend soll ein technologieoffener, marktwirtschaftlich organisierter Kapazitätsmechanismus entstehen, der ein ausgewogenes Zusammenspiel von Erzeugung, Speichertechnologien und Flexibilitäten ermöglicht. Dazu zählen auch Bioenergieanlagen und die Kraft-Wärme-Kopplung.
Auch der Ausbau von Solarkapazitäten soll systemdienlich ausgestaltet werden. Privaten Haushalten sollen Anreize gegeben werden einzuspeisen – jedoch nicht um jeden Preis. Der Netzausbau wird laut Koalitionsvertrag synchron zum Ausbau der Erneuerbaren erfolgen, Windkraftprojekte stärker auf geeignete Flächen fokussiert und die Direktversorgung von Unternehmen erleichtert werden.
Bei Offshore-Windparks will man eine hybride Anbindung von Kabel und H2-Pipeline ermöglichen. In Kooperationen mit Nordseeanrainern wollen die Koalitionäre gemeinsam nutzbare Flächen effizient erschließen und einen ersten hybriden Offshore-Netzanschluss/Interkonnektor realisieren.
Auch bei Bioenergie und Biogasanlagen, Wasserkraft und Pumpspeicherkraftwerken sowie Geothermie sollen ungenutzte Potenziale gehoben und die bestehenden weiterentwickelt werden. Die schrittweise Stilllegung von Kohlekraftwerken erfolgt synchron zum Ausbau alternativer Kapazitäten. Um den Gesamtprozess zu beschleunigen, sind schnellere und einfachere Planungs- und Genehmigungsverfahren vorgesehen.
4. Notwendige Innovationen: Wasserstoff, CCS, CCU
Die Koalition setzt langfristig auf das bisherige Ziel, flächendeckend Wasserstoff einzusetzen. Die Erzeugung soll sowohl über große, systemdienliche Elektrolyseanlagen als auch flächendeckend erfolgen. Ergänzende Importe will die angestrebte Bundesregierung über Energiepartnerschaften sicherstellen. Sowohl die grenzüberschreitende als auch die nationale Infrastruktur für ein Wasserstoff-Kernnetz werden konsequent ausgebaut.
CCS- und CCU-Technologien ergänzen den Ausbau erneuerbarer Energien sowie energieeffizienter Produktionsprozesse. Die Abscheidung, der Transport, die Nutzung und die Speicherung von Kohlendioxid sollen insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors und für Gaskraftwerke gesetzlich ermöglicht werden. Für Kohlekraftwerke offensichtlich nicht. Die Speicherung soll offshore außerhalb des Küstenmeeres in der ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandssockels der Nordsee sowie onshore an geologisch geeigneten Standorten erfolgen.
Einordnung: Evolution, nicht Revolution
Bilden diese Maßnahmen im Koalitionsvertrag nun eine Energiewende 2.0? Eher nicht. Der Koalitionsvertrag enthält viele Elemente der Energiepolitik der Vorgängerregierung, jedoch mit optimierten Zielsetzungen. Aus meiner Sicht sind einige zentrale Themen in ihrer Bedeutung hervorgehoben, ihre weitere Umsetzung wird jedoch noch eine Konkretisierung erfordern, die zu weiteren Herausforderungen führen wird.
Die vorgesehene Entlastung von hohen Energiepreisen ist ein wichtiger Schritt. Jedoch soll dies laut Koalitionsvertrag für Verbraucher nicht per se durch eine Ausweitung des Angebots oder durch mehr Wettbewerb erreicht werden, sondern zunächst durch die Rücknahme von Abgaben. Die Gegenfinanzierung bleibt abzuwarten. Ob dieses Vorgehen langfristig zu einer systemisch tragfähigen Preisentwicklung führt, wird sich erst zeigen. Positiv ist jedoch der Wille und nunmehr die Perspektive für viele Unternehmen.
Ein Zusammenspiel von Erneuerbaren-Ausbau, Kraftwerksstrategie, synchronem Netzausbau und Flexibilitäten ist eine Fortführung der Maßnahmen der Vorgängerregierung – stellt aber keine grundlegende Neuausrichtung dar. So werden u.a. Dunkelflauten und irrationale Verwerfung von Strompreisen durch Einspeisevolumina nicht erwähnt. Die Netzstabilität für die räumliche Verteilung wäre zudem eine wichtige Voraussetzung. Auch wäre eine Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerksblöcken eine Lösung für ein zusätzliches und wichtiges Stromangebot (Baseload) gewesen – nicht unumstritten, aber effektiv. Die Energiewirtschaft hätte dies ohnehin nicht ohne Weiteres umsetzen können.
Umbau der Energiesysteme wird teurer
Deutschland wird ein Energieimportland bleiben – selbst bei zusätzlicher Förderung heimischer Erdgasressourcen. Der Verweis auf die EU und das Bekenntnis zu starken Energiepartnerschaften ist ein Zeichen, mehr in Richtung eines europäischen Strom- und Gasmarktes zusammenzurücken, und daher positiv zu bewerten.
Die Finanzierungsproblematik ist nun erkannt und wird angegangen. Dies wird zu strukturellen Veränderungen der Versorgerlandschaft führen – mit Folgen für Regionen und Kommunen. Klar ist aber auch: Der Umbau der Energiesysteme wird für unser Land teurer und die Umsetzung länger dauern. Ohne privates Kapital auf kommunaler und systemischer Ebene wird der weitere Umbau des Energiesystems ohnehin nicht gelingen. Die Bereitschaft der Kapitalgeber ist jedoch vorhanden – und neue Rahmenbedingungen in der Ausarbeitung.
Damit die bestehende Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht verloren geht, sind langfristig stabile regulatorische Rahmenbedingungen entscheidend. Die angekündigten Vereinfachungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren sind in diesem Zusammenhang ein richtiger und notwendiger Schritt.
Mein Fazit: Der Koalitionsvertrag enthält viele wichtige und gute Ansätze. Es ist jedoch für die Energiewirtschaft charakteristisch, dass langfristig wirkende Entscheidungen nicht kurzfristig verändert werden können. Der eingeschlagene Kurs wird fortgesetzt, mit dem Potenzial zur Weiterentwicklung – sofern die Maßnahmen nun mit Konsequenz, Klarheit und Tempo umgesetzt werden.