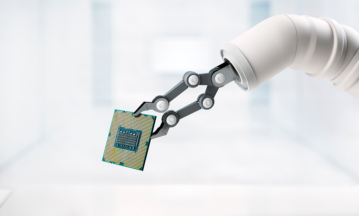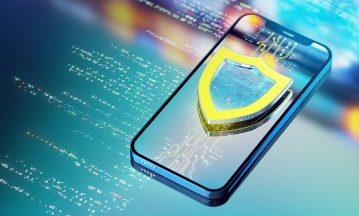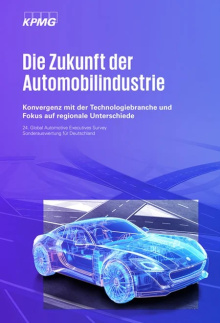Alle wissen, dass in 20, 30 Jahren wahrscheinlich ausschließlich elektrisch betriebene Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein werden. Und doch: Die deutsche Automobilbranche tut sich schwer mit der Transformation ihres Geschäftsmodells, das wohl wie kein anderes das Label „Made in Germany“ repräsentiert. Asiatische Anbieter sind längst weiter, was die Entwicklung von E-Fahrzeugen angeht.
Das Bewältigen dieser Transformation schüttelt die Autoindustrie grundlegend durch und führt zu Umsatz- und Verkaufseinbrüchen. Und als wäre das nicht schon genug, muss sich die Autoindustrie auch mit der Einführung von Strafzöllen beschäftigen. Die Europäische Union (EU) hat jüngst Strafzölle für E-Autos beschlossen, die in China produziert werden. In großem Maße davon betroffen: Die deutsche Autoindustrie, die Teile ihrer E-Flotten in China produzieren lässt beziehungsweise mit chinesischen Partnern zusammenarbeitet. Die deutsche Politik hatte sich zwar gegen die Zölle ausgesprochen, konnte sich mit der ablehnenden Haltung in Europa jedoch nicht durchsetzen.
Schwere Zeiten also für die Autobauer – besonders für die deutschen. Unser Head of Automotive, Andreas Ries, sieht die von der EU verhängten Strafzölle ebenfalls kritisch. Im Interview ordnet er die Situation ein und sagt, was ihm mit Blick auf die deutsche Automobilindustrie zuversichtlich stimmt.
Warum sind die Strafzölle auch für deutsche Autobauer ein Nachteil?
Subventionen spielen auf dem chinesischen Automarkt eine große Rolle. Im Vergleich zu Europa profitieren relevante Wertschöpfungsketten in China von einer unfairen Subventionierung. Hinzu kommt, dass die Kosten für Energie, Arbeit und Bürokratie in China deutlich niedriger sind als in Europa. Strafzölle können auf den ersten Blick diesen Nachteil ausgleichen. Aber nur kurzfristig. Denn Strafzölle sind ein zweischneidiges Schwert. Zwar können sie kurzfristig manchen europäischen Herstellern Vorteile verschaffen, doch langfristig birgt diese Maßnahme Risiken und verstärkt das Feind-Freund-Schema zwischen Europa und China. Aktion provoziert Reaktion: China hat zum Beispiel Zölle auf Branntwein erhöht. Das Land schaut bei Investitionspolitik genau hin und registriert, wer sich für und wer sich gegen die Zölle entschieden hat.
Viele deutsche Autobauer produzieren in China und exportieren von dort aus in die EU. Durch die Zölle werden also auch Fahrzeuge europäischer Hersteller teurer, was Auswirkungen auf deren Wettbewerbsfähigkeit auf dem heimischen Markt hat. Die handelspolitischen Spannungen erschweren den ohnehin schon herausfordernden Transformationsprozess der Automobilindustrie. Strafzölle belasten die finanziellen Ressourcen der deutschen Autobauer, die dringend für Forschung und Entwicklung benötigt werden. Zudem zwingen sie Unternehmen, ihre globalen Produktionsnetzwerke neu auszurichten, was weitere Investitionen nach sich zieht.
Hat China durch die Subvention seiner eigenen Marken einen uneinholbaren Vorsprung gegenüber deutschen beziehungsweise europäischen Marken?
China hat durch die massiven Subventionen – etwa für Hersteller, Käufer, Ladeinfrastruktur und Forschung – einen Vorsprung in der Elektromobilität erreicht und den weltweit größten Markt für E-Autos aufgebaut. Chinesische Hersteller sind technologisch führend, insbesondere bei Batterien, da China die Produktion, Rohstoffkontrolle und Lieferketten dominiert. Dieser Vorsprung ist jedoch aufholbar: Deutsche und europäische Autobauer können mit gezielten Investitionen, strategischen Partnerschaften und politischen Maßnahmen konkurrenzfähig bleiben. Wichtige Ansätze sind der Ausbau der Ladeinfrastruktur, nachhaltige Lieferketten und Kooperationen, zum Beispiel mit Japan und Südkorea. Die EU kann durch Förderungen die Branche stärken und internationale Umweltstandards setzen. Eine Diversifizierung der Lieferketten bleibt dabei essenziell.
Viele deutsche Autobauer haben chinesische Partner. Warum sind diese Allianzen wichtig und nötig?
Die Gemeinschaftsunternehmen deutscher Unternehmen mit ihren chinesischen Partnern sind historisch gewachsen und waren eine von Peking definierte Voraussetzung, um überhaupt Zugang zum Produktionsstandort China zu erhalten. Für die deutschen Autobauer waren die chinesischen Allianzen wichtig und notwendig. Die Gemeinschaftsunternehmen dienten der Einhaltung der chinesischen Vorschriften. Zudem ermöglichten sie ihnen den Zugang zum chinesischen Markt. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern konnten europäische Hersteller von chinesischen Marktkenntnissen, Vertriebsnetzwerken und regulatorischen Erfahrungen profitieren.
Sollten diese Partnerschaften neu überdacht werden?
Diese Win-Win-Situation ändert sich gegenwärtig: die Transformation zur E-Mobilität lässt neue starke Marken auf dem chinesischen Markt entstehen, die ohne ausländische Partner den etablierten Herstellern schnell Marktanteile abnehmen. Die vollständige Beendigung dieser Allianzen im Hinblick auf höhere Strafzölle wäre jedoch zu kurz gedacht, da diese Projekte in erster Linie den Heimatmarkt – also den größten Automarkt der Welt – bedienen. Zweifelsohne aber sollten die deutschen Automobilunternehmen ihre Produkt- und Produktionsstrategie anpassen.
Welche Aspekte sind dabei entscheidend?
Derzeit gibt es Überkapazitäten am Markt. Das bedeutet, es gibt viele Fabriken, die nicht voll genutzt werden. Unternehmen sollten also ihre Strukturen verschlanken, Kapazitäten abbauen und Investitionsprioritäten adjustieren. Konkret heißt das, die Automobilbauer sind jetzt gefordert, neue Produkte und Services zu entwickeln, Produktionsstätten so umzubauen und umzuwidmen, dass dort zum Beispiel Batterien hergestellt oder wiederverwertet werden können. In Zukunft lässt sich Wachstum nicht mehr über Volumen, also die Stückzahl verkaufter Autos, herstellen. Vielmehr geht es darum, Services rund ums Auto zu entwickeln.
Kann die Autoindustrie diese Transformation aus eigener Kraft bewältigen?
Ich bin überzeugt, dass es hierfür gleich mehrere Beteiligte braucht. Deutschland hat das Tempo der E-Auto-Entwicklung unterschätzt und es nicht geschafft, die E-Mobilität aus der Nische herauszuführen. Die Chinesen sind hier wesentlich weiter und bleiben deswegen ein wichtiger Partner. Und Europa benötigt aus meiner Sicht eine klare Industrie- und Förderungspolitik. Die Rücknahme der E-Auto-Förderung war ein Fehler. Der Absatz müsste wieder gefördert werden. Die Automobilindustrie kann nur zusammen mit anderen Playern aus der Politik, von Zulieferern und der Wissenschaft Lösungen finden. Verlässliche regulatorische Vorgaben, eine koordinierte Industriepolitik, die Nutzung von Allianzen sowie eine konsequente Rückbesinnung auf Qualität und Innovation bilden wesentliche Voraussetzungen für einen international fairen Wettbewerb.
Deutschlands Autoindustrie steckt mitten in einer Umbruchphase, kämpft parallel mit anderen Krisenherden – was macht Sie in der angespannten Situation optimistisch?
Deutschland genießt noch immer den Ruf, hohe Produktionsqualität zu gewährleisten. Nicht nur bei der Produktion von Motoren und Maschinen. Auch, wenn es um den Umgang mit Daten und ökologischen Fragen geht. In Europa werden die saubersten und nachhaltigsten Autos gebaut mit den stabilsten ESG-Lieferketten. Der EU AI Act regelt klar, was künstliche Intelligenz darf und was nicht. Mit Blick auf diese Stärken sollten die richtigen Investitionen getätigt werden, damit auf dem Automarkt der Zukunft die erfolgversprechenden Nischen und Kundenwünsch bedient werden können. Dazu gehören zum Beispiel ein Kunden-Rundum-Service, Batterie-Recycling oder die Integration von künstlicher Intelligenz in den Produktionsprozess.